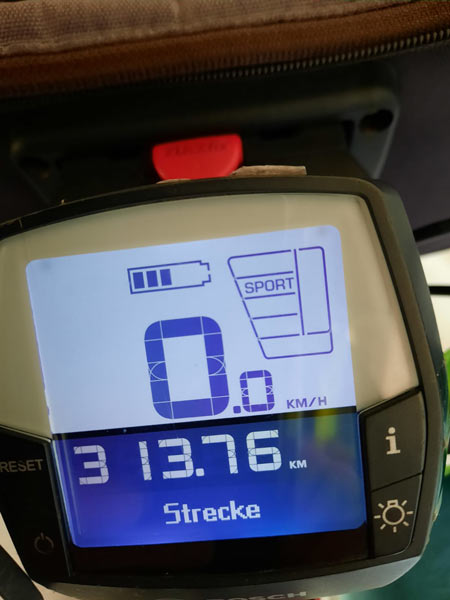Zwischen Tag und Nacht und wenn die Lämmer wieder springen
Liebe Schwestern und Brüder,
Eben habe ich nach einer fast zweiwöchigen „Gehpause“ meine erste langsame Runde im Garten gedreht. Es ist windstill, der Haselstrauch blüht und der goldene Blütenstaub hängt fast schwer, aber auch verheissungsvoll an den Zweigen. Die ersten Veilchen und Krokusse blühen und die Schneeglöckchen auch. Der Winter legt die langen Nächte leise dem Frühling zu Füssen und mehr Tageslicht und Wärme zaubern das Leben neu in die Natur. Es ist friedlich und schön – fast ein Kontrast zu den letzten turbulenten Wochen. Und doch webt sich das Turbulente in diesen Fluss des Lebens, als gehöre es halt einfach dazu.
So bin ich vor knapp zwei Wochen etwas unglücklich im Schnee gelandet und habe mir die Wadenmuskulatur ordentlich verzerrt. Die dringendsten Aufgaben, vor allem das Versorgen von Patienten konnte ich – Dank der Hilfe von Sr. Michaela und Abris altem Rolli und Krücken - einigermassen schaffen.
Mit den Pflegeschülern hatten wir einen Schneeausflug geplant. Das haben die „Grossen“ sich sehr gewünscht. Ich wollte einen Tag vorher, am Sonntag, die Schneelandschaft erkunden und eine Meditation vorbereiten etc. Dann bin ich blöd gefallen und die Exkursion war nicht mehr möglich. Aber ich möchte kurz von diesen „meinen“ Schülern erzählen. Es sind 14 Erwachsene, die voller Eifer und Wissensdurst lernen, fragen, motiviert in die Pflegeeinsätze gehen. Nach einer Woche mit Blockunterricht am Nachmittag sagten sie, es wäre eigentlich zu wenig, nur wieder einmal in der Woche Unterricht zu machen. Da sind Erwachsene von 23 bis 58 Jahren beisammen und lernen und experimentieren und machen an sich selbst Pflegeerfahrungen. Manchmal bin ich so getroffen, wie motiviert sie sind, wie sie erzählen, wie sie froh sind, lernen zu dürfen und wie sie auch sagen: „Warum hat uns das noch niemand gesagt?“ Eine Teilnehmerin, die jeden Tag schwer schuftet, deren Mann vor 23 Jahren erschossen wurde, hat nach vier Monaten ihr ganzes Leben verändert. Sie kann wieder lächeln, ist von einer harten, verschlossenen Person eine von allen geliebte „Mami“ geworden. Als ich ihr neulich zur Pause einen Schokikeks mit ihrem Namen und einem gemalten Smiley an ihren Platz gelegt habe, fing sie zu weinen an und sagte zu allen: „Noch nie in meinem Leben hat auch nur irgendjemand einmal meinen Namen geschrieben!“ Sie hat den Zettel mit Smiley und Namen genommen, den Keks damit eingewickelt und gesagt: „Das nehme ich mit heim, den esse ich nie!“ Die Dynamik in der Gruppe überrascht mich auch. Ich gebe zu, ich hatte wirklich „Schiss“ wie das klappen würde: ich kannte nur drei der TeilnehmerInnen. Und da sind: junge Frauen, Mütter, zwei junge Männer, ein paar Ordensschwestern, zwei Witwen. Es ist fast ein Wunder für mich, wie sie miteinander auch einen persönlichen Weg in diesen Stunden miteinander gehen. Und sie lernen die Pflege der Kranken immer mehr zu lieben und ich bin überzeugt, dass sie in ihren Dörfern gute Arbeit tun werden. Da ich jetzt pausieren musste, konnte ich die Praktikumseinsätze bei den Kranken draussen noch nicht in vollem Umfang begleiten. Dies wird nun bald beginnen.
 So sind nun Miriam und Klodi mit in ein Dorf an der Grenze gefahren. Diesen Mann konnte ich nicht warten lassen. Gani wurde mit seinem Motorradl angefahren. Der Autofahrer hat ihn liegenlassen und ist abgehauen. Als sie ihn fanden, war er schwer verletzt. Er kam mit gebrochenem Jochbein und Schädelhirn-Trauma ins Krankenhaus nach Tirana. Bewusstlos war er da nicht mehr. Sie haben das gebrochene und verschobene Jochbein ohne Narkose sozusagen wieder an seinen Platz geschoben. Schmerzmittel hatte er dafür keine bekommen, nur die Anweisung, nicht zu schreien. Der Augapfel war wie verschoben, kauen kann er immer noch nicht richtig. Und Gani sagte Ärzten und Pflegern von Beginn an, dass es ihn am Rücken schmerzt und brennt und er sich sicher ist, dass er dort eine Wunde habe. Sie sagten, er wäre geröntgt, da sei gar nix! Er hatte schlimme Schmerzen am Rücken, aber keiner reagierte. Gewaschen wird man sowieso nicht. Nach vier Tagen wurde er in schlechtem Zustand entlassen. Dann sahen die Angehörigen die schwer nekrotisierte und infizierte Brandwunde, als sie in daheim anschauten. Der heisse Auspuff vom Motorrad hat sich durch die Kleidung in die Lende von Gani gebohrt. So fanden wir den Patienten schwer krank mit starken Schmerzen, ohne jeglichen Schlaf und irgendwie auch verzweifelt auf seinem Sofa liegend. Die Familie war hilflos. Bereits nach der ersten Versorgung ging es ihm besser. Gani konnte nicht glauben, dass er ernst genommen wird, dass er sagen darf, wie sehr es weh tut usw. Als wir gestern bei ihm waren, da begrüsste er uns an der Haustür und strahlte uns an. Es ist ihm nicht mehr schwindelig, er hat sein Gleichgewicht wieder gefunden. Und er kann sich an seinen vier jungen Lämmern freuen, die auf seiner Weide neben dem Haus rumhüpfen und auch für Gani den Frühling bringen. Wenn er uns dann immer mit Tränen in den Augen die Hände küsst, dann denke ich daran, wie dieser Mann erniedrigt wurde und wie er sein Trauma langsam überwinden wird. Und er wird wieder seine Lämmer und Schafe versorgen können.
So sind nun Miriam und Klodi mit in ein Dorf an der Grenze gefahren. Diesen Mann konnte ich nicht warten lassen. Gani wurde mit seinem Motorradl angefahren. Der Autofahrer hat ihn liegenlassen und ist abgehauen. Als sie ihn fanden, war er schwer verletzt. Er kam mit gebrochenem Jochbein und Schädelhirn-Trauma ins Krankenhaus nach Tirana. Bewusstlos war er da nicht mehr. Sie haben das gebrochene und verschobene Jochbein ohne Narkose sozusagen wieder an seinen Platz geschoben. Schmerzmittel hatte er dafür keine bekommen, nur die Anweisung, nicht zu schreien. Der Augapfel war wie verschoben, kauen kann er immer noch nicht richtig. Und Gani sagte Ärzten und Pflegern von Beginn an, dass es ihn am Rücken schmerzt und brennt und er sich sicher ist, dass er dort eine Wunde habe. Sie sagten, er wäre geröntgt, da sei gar nix! Er hatte schlimme Schmerzen am Rücken, aber keiner reagierte. Gewaschen wird man sowieso nicht. Nach vier Tagen wurde er in schlechtem Zustand entlassen. Dann sahen die Angehörigen die schwer nekrotisierte und infizierte Brandwunde, als sie in daheim anschauten. Der heisse Auspuff vom Motorrad hat sich durch die Kleidung in die Lende von Gani gebohrt. So fanden wir den Patienten schwer krank mit starken Schmerzen, ohne jeglichen Schlaf und irgendwie auch verzweifelt auf seinem Sofa liegend. Die Familie war hilflos. Bereits nach der ersten Versorgung ging es ihm besser. Gani konnte nicht glauben, dass er ernst genommen wird, dass er sagen darf, wie sehr es weh tut usw. Als wir gestern bei ihm waren, da begrüsste er uns an der Haustür und strahlte uns an. Es ist ihm nicht mehr schwindelig, er hat sein Gleichgewicht wieder gefunden. Und er kann sich an seinen vier jungen Lämmern freuen, die auf seiner Weide neben dem Haus rumhüpfen und auch für Gani den Frühling bringen. Wenn er uns dann immer mit Tränen in den Augen die Hände küsst, dann denke ich daran, wie dieser Mann erniedrigt wurde und wie er sein Trauma langsam überwinden wird. Und er wird wieder seine Lämmer und Schafe versorgen können.
Ob Violeta auch wieder ihrer täglichen Arbeit nachgehen kann, dies wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Sie hatte einen schweren Autounfall. Sehr schnell wurde sie wieder aus dem Traumaspital in Tirana heimgeschickt. Beide Hände waren Knochenmatsche, das rechte Bein von oben bis unten zertrümmert. Die Familie lebt sehr ärmlich und sie brauchte dringend ein Krankenbett. Gott sei Dank können wir – Dank der Transporte – immer wieder Krankenbetten verleihen. Violeta war in schlimmem Zustand. Aus der operierten Wunde am Bein lief die Siffe – die Drainage wurde einfach gezogen, als sie am zweiten Tag nach der schweren Operation entlassen wurde. Das Knie war kein Knie mehr: ein schwarzer, blauer, dicker, harter Bollen gaffte uns entgegen. Schmerzmittel hatte sie keine, die vom Krankenhaus mitgegebenen Blutverdünner waren aus. Der Mann hatte hier alle Apotheken abgeklappert, aber nirgendwo die Spritzen bekommen, auch konnte er sowieso nicht mehr bezahlen. Schwester Michaela fuhr noch den ganzen Abend rum, um dieses wichtige Medikament aufzutreiben. Irgendwie fühlte ich mich in diesem Moment hilflos und wütend. Das gebe ich zu. Dann siegte in mir der Wille, diese Frau nicht allein zu lassen.
Und Sr. Michaela guckte mich sehr ermutigend an. Sie merkte wohl, dass mir nicht mehr wohl war. So etwas hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Ich begriff, dass es immer noch Steigerungen in dem gibt, was es eigentlich nicht geben darf. Und die Augen von Violeta guckten mich treuherzig an. Sie hatte nicht gemerkt, dass ich am liebsten das alles nicht sehen wollte, dass ich es einfach nicht wahrhaben wollte, was ich da sah. Aber es war ja schon passiert und da war es in mir wieder mal, dieses: „Lauf weg, wenn Du kannst!“ Ich lachte über mich selbst und wusste, dass auch hier der HERR mit im Boot ist. Und so packten wir es an und versorgten Violeta. Zum Schluss sahen wir noch, dass die Beinschiene völlig ungepolstert war und ihr schon Blasen durch Druck verursacht hatte. So improvisierten wir und bauten ein gutes Polster, um gut zu lagern. Die beiden Hände und Handgelenke waren eingegipst mit einem Gips, den man höchstens im ersten Weltkrieg noch gemacht hat. Die Finger waren geschwollen, aber beweglich. Schwester Michaela zeigte mir dann die letzten Sätze vom Entlassungspapier und da stand in schwarzen Buchstaben: „Zur Rente anmelden.“ Wir guckten uns an.
Wir entschieden, erstmal nichts davon zu sagen. Alles zu seiner Zeit. Dann kam mir die Idee, dass Violeta irgendwas mit ihren Fingern tun muss, um nicht in die Depression abzugleiten. Sie war bereits in einer Krise. Über Nacht fiel mir ein, dass ich noch eine Handharfe aufbewahrt habe. So brachten Miriam und ich ihr diese beim nächsten Besuch vorbei. Als diese Frau mit vier Kindern dieses Instrument sah, da strahlte sie. Ich legte es ihr aufs Bett in ihre Gipshände. Sie fing sofort an, die Saiten zu streichen – mit Gips. Dann sagte sie: „Schon als Kind wollte ich so ein Instrument. Nun habe ich so etwas bekommen.“ Und sie spielte einfach. Glück finden im Unglück. So hat uns in diesem Moment Violeta gelehrt. Sie spielt einfach. Und nun ist es Zeit für sie, dass in Tirana der Gips wegkommt. Sie war heute dort und wir wissen noch nicht, wie es ihr geht. Aber wir werden mit ihr üben und üben. Sie wird im Frühling vielleicht nicht wie die Lämmer springen, aber wenigstens mit Mut die ersten Schritte tun dürfen.
Und die Grippewelle hier ist langsam auch am Abklingen. Unsere zwei Jungs hatte es vor zwei Wochen schwer erwischt, dann auch Miriam, unsere so hilfreiche und tolle Praktikantin. Es waren schwere Tage, vor allem, weil die Kids so hohes Fieber hatten und wirklich gelitten haben. Gott sei Dank ist auch Antonio in solchen Zeiten absolut kooperativ und schluckt alle Medizin, wenn man ihm es erklärt. Er war sehr schwach, aber er hat auch eine starke Natur.
So könnten wir jeden Tag viele Geschichten erzählen. Wir leben und erleben intensiv und das sehe ich als Geschenk des Lebens. Und so stehen wir vor der Fastenzeit. Seit einigen Tagen fällt mir immer wieder ein Satz des Jeremia ins Herz: „ICH WILL EUCH ZUKUNFT UND HOFFNUNG GEBEN!“ Ich glaube, ich werde diese Zusage auch als Aufgabe mit in diese kommende Heilszeit nehmen. Viele hier haben die Hoffnung auf eine menschenwürdige Zukunft in diesem Land verloren. Diese Tage haben wir erfahren, dass lt. Volkszählung, die nicht veröffentlicht ist, nur noch 1,3 Millionen albanische Bewohner in diesem Land leben. Dies können wir nicht verifizieren, aber wir wissen, wie viele der neu gebauten Häuser hier leer stehen, wie viele Jugendliche über Nacht immer noch illegal verschwinden, wie viele Familien gehen, wie viele Ärzte und Krankenschwestern fehlen. Und da flammt diese Zusage der Zukunft und Hoffnung nun seit ein paar Nächten immer wieder in meinem Kopf, in meinem Herzen und in meinem Glauben. Und so möchten wir jeden Tag, der neu ist, jeden Frühling, der vom Leben spricht, jedes Lamm das hüpft und jeden Menschen, der hier aus dem Klösterli geht und wieder lächeln kann auf die andere Seite der Negativwaage legen und diese Zusage einlösen. Vielleicht hat Gott uns dazu geschaffen? Und am Ende dieses Briefes ist es mir und uns ein Bedürfnis, wieder DANKE zu sagen. Ihr helft viel, Ihr betet viel für uns, Ihr gebt viel und opfert viel. Und Ihr gebt Zukunft mit der kleinsten Spende, mit jedem wohlwollenden Gedanken für uns. Vergelt`s Gott.
Mit herzlichen Segenswünschen für eine gute, erfüllte Fastenzeit grüssen Euch
Sr. Christina und Sr. Michaela

Nachruf aus Albanien für Schwester Bernarda
Schwester Bernarda, Du bist nun vorausgegangen zu Gott. Was möchte ich Dir aus Albanien – von mir persönlich und von uns allen hier – nachrufen?
Da ist Vieles, was mir im Gedenken an Dich vorbeizieht. Eines zuerst: irgendwie habe ich den Eindruck, dass Du uns schon immer voraus warst: in Deiner Gelassenheit mit trockenem Humor, in Deiner inneren Hellsichtigkeit, Deinem Frohsinn und Deiner Originalität. Und Deine Liebe und Fürsorge für uns hier im Armenhaus Europas hat uns alle im Klösterle tief beeindruckt. Du warst monatelang hier, um in der Küche zu helfen, und unseren Mitarbeitern mit viel Geduld und Zuwendung das Kochen beizubringen. Du hast es geschafft, ohne Sprachkenntnisse, den Jugendlichen einen Kurs in Ernährungslehre zu geben und ganz praktisch mit einem Stück Papier zum Metzger zu marschieren, um ihm zu zeigen, welches Stück Fleisch vom Rind du brauchst. Interkulturellen Dialog hast du nicht theoretisch gelernt, Du hast einfach hier mit den Menschen gelebt und zwar authentisch. Du hast den ganz kleinen und schwer kranken Abraham jeden Tag im roten Kinderwagen spazieren gefahren und dabei den Rosenkranzpsalter gebetet und ganz sicher gesagt: „den kriegen wir schon durch“. Ich sehe Dich noch singend in der Kapelle sitzen, während das Hochwasser fast zum Haus reingelaufen ist und wir am Evakuieren waren. Es war kurz vor Weihnachten und Du hast gesungen: „ihr Kinderlein kommet“. Das hat uns Druck genommen, wir waren durch dieses einfache Lied auf etwas verwiesen, was ich kaum beschreiben kann - vielleicht so: „Es gibt noch etwas anderes als die Sorge ums Wasser. Da wird in Betlehem ein Kind geboren. Etwas wichtigeres gibt es doch nicht!“ Schwester Bernarda, es passiert uns heute noch – wenn irgendwas Schwieriges oder Stressiges vor uns ist, dann denken wir an diese Episode oder eine fängt an, es schmunzelnd dieses Lied zu singen. Eines Tages, als wir sehr müde waren, hattest Du uns zum Essen eine wundervolle Zitronencreme gezaubert – einfach aus dem Nichts. Du hast uns auch ein wenig verzaubert, Schwester Bernarda. Und nun bist Du uns vorausgegangen und ich stelle mir gerade vor, wie Du sagst: „Hier gibt es Unmengen von Enten und die brauchen was zum Futtern“. Schwester Bernarda und ich bin gewiss, dass die Engel Dich zum Paradiese geleiten und Dich dort auch die albanischen Märtyrer empfangen.
Danke!
„DA WAR LIEBE DRIN“
Sr. Christina, Sr. Michaela, Abraham, Toni, Irena, Syka, Lezi, Aferdita, Flutura, Sokol, Berti und so viele andere hier.

Armelas Auferstehung
Liebe Schwestern und Brüder,
auf Ostern hin möchten wir Euch wenigstens einen kleinen Gruss schicken – mit dem tiefen Wunsch der österlichen Hoffnung und Freude für Euch. Möge die Auferstehung in die persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen münden und die Kraft des Lebendigen uns das Halleluja über alles Destruktive und Hoffnungslose aus der Tiefe unserer Seele quellen lassen.
So ist es wohl bei Armela geschehen. Die Sechzehnjährige ist seit Herbst in meiner Firm-gruppe. Immer lag ein Schatten von Verbissenheit und auch Trauer auf ihrem Sommer-sprossengesicht. Sie war oft wie gar nicht da oder wirkte desinteressiert. Aber sie kam immer. Und dann, zwei Wochen vor Ostern, durften die Firmlinge ihre Kreuzwegstation töpfern. Alle Teilnehmer hatten zum ersten Mal überhaupt den Ton in der Hand. Sie waren zögerlich. Aber dann begeistert – ausnahmslos alle. Zu Armela schaute ich etwas besorgt, da sie erstmal einfach nur den Ton anguckte. Armela krümelte irgendwie entgeistert mit der Erde rum. Ich war gespannt. Irgendwann in den nächsten Minuten sah ich sie dann konzentriert mit dem Ton werkeln. Ihre Gesichtszüge waren irgendwie verändert – konzentriert, trotzdem entspannt und wie von einem fernen Geheimnis seltsam berührt. Dann formte sie die Grablegung und Jesus als den Auferstandenen.
Armela strahlt. Dann sagt sie schüchtern und mich spontan in den Arm nehmend: «Ich habe gefunden und weiss jetzt, dass es stimmt!»
Frohe gesegnete Ostern und in grosser Dankbarkeit für alles Wohlwollen, jedes Gebet und jegliche Hilfe
Sr. Christina und Sr. Michaela mit der Klosterfamilie in Dobrac, Ostern 2023

Klagelieder
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat.
Der Januar ist fast verflogen, als wäre er ein kurzer, aber eindrücklicher Gedanke gewesen. Gerne schicken wir Euch den ersten Rundbrief von hier. Wir hoffen, Ihr alle hattet einen guten Jahresbeginn und ich denke, wir teilen mit Euch die Hoffnung auf Frieden. Bei uns haben die ersten Wochen im Jahr turbulent begonnen und die Langeweile lauert bei uns sicher nicht an der Türe. In den vier Wochen hatten wir viel Regen und die Hochwassermarke ist immer noch nicht überwunden. Nach wie vor stehen Häuser am Stadtrand im Wasser und der Pegelstand des Sees ist hoch. Bislang sind wir mit einer nassen Zehe davongekommen, und wir sind dankbar dafür. Vor zwei Wochen hat uns dann ein Erdbeben aus dem Bett geholt, aber auch das lief bei uns glimpflich ab – im Südwesten hat es ein Dorf aber ziemlich erwischt. Gleich darauf ist in der Früh um 4 Uhr bei einem Nachbarn eine Bombe explodiert. Die Erschütterung sitzt mir noch heute in den Knochen. Wir gingen gleich am Morgen zur Grossfamilie und die zwei jugendlichen Jungs nahmen wir erstmal mit zu uns ins Kloster. Die massiven Schäden am Haus sind fast behoben, die Angst ist geblieben. Rache für irgendwas! Der Grossvater sagte mir mit zitternder Stimme: «Schwester, ich bin schon so alt, aber so was habe ich noch nie erlebt. Warum tut das jemand, wir schulden niemanden etwas, wirklich nicht!»
In unserer Ambulanz häufen sich die Patienten, wir haben in der Woche bis zu 70 Hilfe-suchende, die behandelt werden müssen. Und in diesem fast primitiven Raum, der einmal, als wir hier begonnen haben, als Bügelzimmer gedacht war, da geschieht viel mehr als nur die Heilung des Körpers: da brechen andere Wunden auf; die Wunden der Seele, grausame Erinnerungen, Lebensgeschichten von Not und Elend, Schuld und Sühne, begrabene Er-wartungen und neu erstandene Hoffnungen, Aussichtslosigkeit und doch leben müssen, Annahme von Leben und Tod. In die Ambulanzmauern sind diese Geschichten einge-schrieben, wie auch in unser Herz – bis zum Ende unserer Tage. Der Allmächtige wird dann das wandeln, was wir nicht heilen konnten. Aber viele gehen auch erleichtert von uns. Manche möchten, dass wir den Heilungsprozess verzögern, um weiterhin kommen zu können.
In der letzten Woche hörten wir von Meningitis und Encephalitis, vor allem bei Kindern. Gestern ist in Tirana im Kinderspital die kleine Enkelin von Dushe, unserer Romafreundin, an dieser gefährlichen Hirnentzündung gestorben. Die Kleine hat 10 Tage gekämpft. Dushe ist in tiefer Trauer. Wir treffen im Kinderzentrum die ersten Vorsichtsmassnahmen, vor allem sensibilisieren wir die Erzieherinnen und Eltern zum Erkennen erster Symptome. Da wir auch eine schwere Grippeepidemie hier haben, überlegen wir uns genau, wie wir vorgehen, um keine Panik auszulösen. Dem Gesundheitsamt in Shkoder war bislang gar nichts vom Auftreten der Erkrankung bekannt.
Die häusliche Versorgung von schwerkranken und pflegebedürftigen Patienten nimmt zu, der Bedarf ist rapid am Anwachsen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass in fast jeder Sippe jemand bettlägerig ist. Die letzten Wochen sind wir sehr weit in ein Dorf «am Ende der Welt» gefahren. Dort liegt ein Mann in den Fünfzigern mit offenen Krebsgeschwür im Unterbauch in furchtbarem Zustand. Die Familie ist hilflos. Gott sei Dank kam noch eine andere Ordensschwester, die jeden Tag die Verbände macht. Sie spricht kein albanisch und so ist die Verständigung mit den Betroffenen sehr schwierig. Wir haben eine gute Zusammenarbeit vereinbart und sie ist froh um unsere Erfahrung. Nun hat der Patient zu bluten begonnen, der Tumor hat sozusagen ein Gefäss angefressen. Er verlangt uns regelmässig. Seine Klage ist stumm – er hat wohl gelernt, stark zu sein. Aber seine Augen reden von Angst und der grossen Frage: «Warum denn ich – meine Familie braucht mich noch?» Dieser Mann wurde in Italien operiert. «Leider erfolglos» steht auf den Entlassungspapieren der Klinik. Mit ein paar mickrigen Schmerzmitteln und 70.000.-- Euro Schulden wurde er zurück in sein Tabakdorf geschickt. Dieser Vater kann nicht sterben, weil er noch die Schulden abarbeiten möchte – mit Tabakanbau. In dieser Gegend gibt es nichts anderes als giftige Tabakpflanzungen.
Und dann ist da Zen aus den Bergen. Er hat sich mit seiner Familie am See angesiedelt. Er kommt und bittet um einen Besuch bei seiner Frau. Er sagt, dass diese seit vier Jahren nicht mehr weiss, was sie tut. Jetzt kann auch er nicht mehr und seine Kinder sind im Ausland, eine Tochter ist weiter weg in den Bergen verheiratet. Ich weiss, ich muss schnell hin, denn Zen kommt nicht mehr zurecht. Sie leben hier am See, weit draussen in der Siedlung. Der Achtzigjährige wartet schon am Holperweg auf mich. Er ist rüstig und auch geistig fit, aber nun auch finanziell am Ende und hilflos. Bereits im Hof höre ich eigenartige Laute: ein Trällern, dann ein Gurgeln, Trällern, eine hohe Stimme, dann ein langes Klagen, das sich wie in den Schluchten der Verfluchten Berge des Dukagjin verflüchtigt, um dann aber wieder im Trällern aufzutauchen. Ich denke fas automatisch an die Klagefrauen hier und horche auf und Zen nickt leise und ich weiss, was er sagen möchte: «Meine Frau!» Ich fasse ihn kurz am Oberarm und nicke ihm mein Verstehen zu. Er braucht sich nicht zu schämen. Dann trete ich in den Klageraum. Am Sofa sitzt eine alte Frau mit weissem Kopftuch. Sie ist mit einem Kabel an das Sofa gebunden. Der Mann sagt entschuldigend, dass er seine Frau anbinden muss, da sie sonst aufsteht und sofort hinfällt. Ich nicke ihm zu. Ob lIiria mich wahrnimmt, kann ich nicht sagen. Als ich mich auf Augenhöhe zu ihr niederknie, klagt und trällert sie weiter, aber ich meine, sie hat mich flüchtig mit ihrem Blick gestreift. Dieser Blick ist tief und geheimnis-voll wie die Schlucht im Dukagjin. Ich berühre vorsichtig ihre Hand. Sie zieht diese nicht zurück, aber erwidert auch nicht den leichten Druck. Ich setzte mich neben ihr aufs Sofa. Ich kann keinen Widerstand wahrnehmen, aber auch keine positive Reaktion. Alles wirkt versenkt wie in die Tiefe einer Schlucht! Auf ihren Namen reagiert sie auch nicht – sie hat wohl für sich einen anderen Namen gefunden – dort, wo ich sie nicht erreiche. Ich spüre, wie ich in mir suche und suche. Ich möchte sie erreichen – irgendwie erreichen. Und ich spüre, wie ich ein Zeichen von ihr ergattern möchte, ein Zeichen, dass mir ihre Klage deutet. Aber da spüre ich Scham in mir: ich entschuldige mich leise bei Iliria: das darf ich nicht!
In diese Schlucht der Klage muss sie mich führen – wenn sie möchte. Und dann erzählt mir ihr Mann ihre Geschichte: Er sagt, sie war völlig normal, bis zu dem Tag, der ein furchtbarer Tag war. Vor vier Jahren wurde ihre Tochter vom eigenen Mann mit dem Spaten erschlagen, bzw. grausam in Stücke gehauen. Seitdem ist Iliria – die Freie - in die Schlucht gefallen und weiss nicht mehr, was sie tut, meint er. Sie war damals 66 Jahre alt. Mir schnürt es die Kehle zu. Ich brauche einen Moment. Dann bitte ich den Mann in den Korridor und frage ihn dort nach dem Namen der Tochter. Sie hiess Lumturia - die Glückselige! Ich gehe zur Frau zurück, knie mich zu ihr runter und fasse sie nochmal ruhig an den Händen. Sie trällert und klagt weiter. Und ich handle nun einzig «aus dem Bauch raus». Ich nehme ihren Klageton auf und flechte den Namen ihrer Tochter ein: LUMTURIA -LUMTURIA. Dann passiert etwas Grosses:
Für einen recht langen Augenblick verstummt Iliria. Sie guckt mich nun aus Augen an, die von weither kommen – aus der Tiefe der Schlucht. Und dann weichen ein paar klare Tränen dieser jahrelangen Klage. Sie laufen ihr über beide Wangen. Dann ist alles wieder wie vorher und doch ganz anders. Wir haben uns getroffen – im Irgendwo. Und ich flüstere wohl mehr, als ich ihr sage: «Deine Lumturia ist bei deinem Gott und du hast sie nie vergessen.»
So ist es bei uns schon Frühling geworden und die Osterglocken blühen neben den Christ-rosen. Es ist in der Natur, als wäre die Zeit «alles in allem». Und ich denke oft an das, was in unserer Ordensweisung steht: «Den Augenblick leben und heiligen!»
Von Herzen grüssen wir Euch von unserem Klösterle und danken für alle Hilfe, alles Wohlwollen und jedes Gebet, um das wir bitten.
Gottes Segen mit Euch
Sr. Christina und Sr. Michaela

Der Rauchmantel der Muttergottes und wenn alles ein wenig wackelt
Liebe Schwestern und Brüder
Wir haben einen wunderschönen Oktobersonntag und eben hat in Elbasan die Erde gebebt. Stärke 4 auf der Skala. Ja, gerade ist alles ein wenig «wackelig» und manchmal wanken hier für die Menschen die Grundfesten auf allen Ebenen des Lebens, wie es scheint.
Und dennoch: ein wunderschöner Tag und Leben allemal. Drüben beim Nachbarn glänzen die reifen blutroten Granatäpfel und warten auf die Ernte. Manchmal ist es hier so schön, dass es fast weh tut. Und dann wieder ist die Erde vom Blut getränkt, wie ein paar Tage vorher mit einem Blutrachemord an einem 18-jährigen gleich drüben – 500 Meter weit weg in Kiras.
Ich möchte Euch ein wenig konkret berichten und vor allem zuerst einen grossen Dank an Euch alle sagen. Eure Unterstützung in jeder Hinsicht ist gross. Die Zeiten sind schwieriger geworden – wir spüren es jeden Tag. Und umso mehr sind wir natürlich dankbar für alle Hilfe, für jedes Gebet, für jedes Zeichen Eurer Solidarität. Und die ist gross. DANKE.
Ja, der Granatapfel ist reif. Ich liebe das tiefrote Glänzen dieser Früchte, den blutroten, ein wenig herben Saft, der schmeckt, wie der albanische Herbst. Eben habe ich ein Glas dieses Lebenssaftes getrunken. Julia, die derzeit mit uns ist, presst seit zwei Stunden Flasche für Flasche. Und dann gibt es daraus noch Granatapfelgelee. Wie ich so nebenher den Saft schlürfe, da denke ich an die noch junge Frau, für die wir vor drei Tagen unbedingt Blut gebraucht haben – so rot und gut wie der Saft des Granatapfels. Irena hatte die Schwer-kranke gebracht und sie war so blutleer, dass sie nur noch durchsichtig weiss glänzte. Wir wagten nicht, sie aus dem Auto zu lassen, damit sie nicht zusammenbricht. Ihr Hämoglobinwert war so tief, dass es fast ein Wunder war, sie noch bei Bewusstsein zu finden. «Sofort ins Krankenhaus» lautete da unsere Anweisung. Dann kam der Anruf von Irena: «Die haben kein Blut, ihre Blutgruppe gibt es nicht in der Blutbank!» Wir haben inzwischen für solche Patienten so ein kleines privates Netzwerk für potentielle SpenderInnen und das hat bislang relativ schnell funktioniert. Alle kontaktierten wir, aber wir haben Pech. Der eine hatte vor vier Wochen gespendet, die anderen waren krank mit Covid, andere nicht erreichbar. Ich spürte, wie ich in solchen Situationen dann auf «Hochtouren» laufe. Ich wusste ja, dass diese Frau weiter blutet und sie das Blut dringendst braucht. Ich betete um einen Einfall – ich bin in solchen Fällen einfach der Überzeugung, dass der Himmel den Überblick hat und wir halt unsere Antennen weiter ausfahren müssen. Nun, es ging gut. Wir fanden schnell über Don Gjovalini Spenderblut. Und die Frau wurde nun gestern operiert und kann – so Gott will – überleben.
In der Ambulanz haben wir sehr viele Patienten – die letzten drei Wochen waren es jede Woche zwischen 60 und 70 Kranke. Innerhalb von zwei Tagen hatten wir 5 Verdachtsfälle auf Tollwut und diese Sache hat uns in Trab gehalten und mir auch ein paar schlaflose Nächte gemacht. Es gibt hier im Land derzeit keine Tollwutimfpung für Menschen. Nun, der Impf-stoff wurde aufgetrieben und die Patienten sind im guten Heilungsrozess und auf der sicheren Seite.
Draussen in den Dörfern und auch in der Stadt Shkoder häufen sich die Pflegebedürftigen, die wirklich in den Betten dahinsiechen. Wir sind da gefordert. So fuhren wir vor einigen Tagen zu Zef, der seit Monaten dahindämmert. Das Krankheitsbild sieht in etwa so aus: Er hat einen operierten Hirntumor, Diabetes, ein amputiertes Bein, das andere ist am Verfaulen und er dämmert tagsüber dahin, nachts schreit er vor Schmerzen. Zef war am Vormittag beim Hausbesuch nicht zu erwecken, aber er ist in einem jämmerlichen Zustand. Die Tochter und ihre junge Schweigertochter pflegen ihn. Da er nachts aktiv ist, müssen sie nachts wachen. Dann führten sie uns in das andere Zimmer. Dort liegt die Schwester von Zef. Sie hat seit fünf Wochen ein gebrochenes Becken. Was genau gebrochen ist, konnte man uns nicht sagen. Durch falsche Lagerung ist das Bein voll nach aussen gedreht und in Fehl-stellung. Ob der Bruch so falsch zusammengewachsen ist, wissen wir nicht. Diese Frau hat ebenfalls starke Schmerzen. Langsam wird es kalt und im Krankenzimmer der Frau roch es bereits feucht-schimmelig. Wir konnten einen Ofen und ein Krankenbett zusagen, ebenfalls Schmerzmittel, ein weiteres Röntgen usw. Wieder und wieder ist häusliche Pflege notwendig insbesondere die Anleitung der Angehörigen. Die junge Frau hat uns alle umarmt, dass wir gekommen sind. Und mir ist klar, dass wir auch sie nicht alleine lassen dürfen. Sie ist eine von vielen, die als pflegende Angehörige Hilfe und Ansprache und Anleitung braucht. Die anspruchsvolle Pflege, die Sorge, weil das Geld nicht reicht, die Frage wie es weitergehen soll, wenn es nun kälter wird und weder Strom noch Essen reichen, rauben die Hoffnung und kosten Lebenskraft. Diese Frau ist so jung und hat noch eine kleine Tochter. Ihr Mann versucht in Montenegro als Tagelöhner ein paar Kröten zu verdienen. Die Fahrtkosten dorthin kosten inzwischen fast mehr als er verdient. Wir arbeiten fieberhaft an einem Projekt für häusliche Pflege, aber die Planung braucht noch etwas Zeit. Es ist mir ein Anliegen, dass die Pflegebedürftigen nicht allein in den Wohnungen dahinsiechen und schlichtweg im Bett verfaulen. Jeden Tag kommen Angehörige, um Salbe für Pflegebe-dürftige, die bis auf die Knochen wund gelegen sind, zu holen. Wir sehen da elende Bilder, machen unsere Salbe, geben Verbandszeug mit (was wir halt haben) und geben kurze Anleitung, wie sie die Patienten versorgen sollen. Wir schaffen es nicht mehr, alle aufzusuchen. Die Krebskranken und Sterbenden rufen uns und wir versuchen wenigstens da präsent zu sein, zu lindern, beizustehen und die letzten Dienste zu tun. So konnte Isa nun vor drei Tagen seinen letzten Weg antreten. Er kam vor einem halben Jahr mit einem offenen Tumor am Ellbogen hierher. Er wusste nicht, dass er bereits voller Metastasen war. Wir begleiteten ihn und er wollte von mir wissen, was mit ihm los sei. Er war so ein tapferer Mann und er kam in unsere Ambulanz, so lange er nur konnte. Nun lag er die letzten Wochen im Bett und wir konnten ihm ein Pflegebett bringen, auch Schmerzmittel. Er sagte mir beim letzten Besuch, dass er schon bereit wäre, aber seine Angehörigen wüssten halt nix. Sein Dank für die letzten Monate hat mich sehr berührt und er sagte: «Ich habe einen Menschen getroffen. Jetzt kann ich fortgehen!» Oft denke ich, dass wir sehr begrenzt sind in unserem Tun – mit nix sozusagen vor den Patienten stehen. Und doch: etwas haben wir uns in diesen Jahren sozusagen angeeignet: «Mensch sein kann man immer».
Da passiert dann auch so was: Wir haben im Livade einen alten Mann, der vor einigen Monaten zwei Wochen im Koma lag mit durchbohrter Lunge nach einem Unfall. Wir wurden gerufen und ich fand ihn gurgelnd, zischend und brodelnd vor. Die Notambulanz kam nicht, so wurde er mit einem alten Auto ins Spital transportiert. Unser Gjelosh hatte eigentlich keine Chance, aber er ist zäh. Er hat das überlebt. Kurz vor seinem Unfall hatten wir ihm und seiner Frau die Muttergottes von Lourdes gebracht – für ein paar Tage. Die Menschen hier sind so angewiesen auf etwas «Konkretes», das sie auf den Himmel verweist. Gjeloshi war damals schon bettlägerig und wollte, dass wir die Muttergottes auf die Kommode vor sein Bett stellen. Nun, diese Tage war es Zeit, sie wieder für die nächste Hauswanderung zu holen. Und siehe da: Gjelosh, der alte Zigarretenraucher, hat die Muttergottes mit seinem Rauch gebräunt. Das Material der Statue hat den Rauch förmlich eingesaugt. Nun trägt sie einen leicht braunen «Rauchmantel» und steht in unserem Konvent bis zum nächsten Krankenbesuch. Tja.
Neulich, als ich sie da so im Konvent angeschaut habe, hatte ich glatt die banale Frage, ob der Heilige Josef die Muttergottes auch ab und zu mit Tabak eingeraucht hat oder mit anderem Raucherzeugs? Könnte ja sein. Und sie erinnert mich halt an das Menschliche, mit dem sie nun bekleidet ist.
Unsere Kids im Kindergarten sind alle sehr lebendig. Gott sei Dank. Eklatant auffällig ist, dass vor allem die Vier- und Fünfjährigen nach dem Wochenende beim freien Spielen ziemlich ausschliesslich «Krieg zwischen Ukraine und Russland» spielen. Mit Bausteinen und Lego, mit Stühlen und Bänken bauen sie «Front» und Gewehre und brüllen dazu. Wir wissen noch nicht so recht, wie wir da unterbrechen. In jedem Fall versuchen wir mit gelenkter Bewegung, mit Kissenschlachten usw. ein wenig umzulenken. Klar ist: was die Erwachsenen tun, spielen die Kids.
In diesem Schuljahr kommen bereits drei Kinder zur Frühförderung. Sie sind behindert und haben bislang noch nie Förderung bekommen. Und vor einigen Tagen kam ein Mädchen mit vier Jahren mit den Eltern und der Leiterin des Sozialdienstes. Die Kleine erlebte wohl ziemlich lange Gewalt in einem Kindergarten. Sie geriet in Panik, als sie bei uns durch die Tür gehen sollte. Der Vater blieb mit ihr draussen und nach einiger Zeit spielte sie mit Sr. Michaela ein wenig Ball – mit Distanz. Dann gab ich Sr. Michaela unser «Therapiekrokodil» aus der Ambulanz und das löste wieder mal den Knoten. Die Kleine näherte sich und «biss» Sr. Michaela mit dem Krokodil. Endlich hatte sie wohl einen starken Helden mit sich, der sich auch wehren kann. Sie liess das Krokodil fressen und fressen. Dann geschah etwas Kolossales für alle: unsere Haustüre war offen geblieben. Obwohl die Eltern gesagt haben, dass sie nirgends mehr hingeht, kam sie plötzlich doch ins Haus. Es war Zeit zum Abendessen und alle von uns gingen bereits zu Tisch – ausser ich. Die Kleine marschierte rum und ging in den Konvent, wo alle am Tisch beim Essen sassen. Da sah sie Antonio, wie er in seinem Teller das Essen bekam. Schwups nahm sie ihm das Teller aus der Hand schnappte sich den Löffel und ass und ass – im Stehen. Zu sitzen war ihr noch zu gefährlich. Und sie fühlte sich wohl und wollte bleiben. Die Eltern waren fast überwältigt von dem, was sie erlebten.
Die Muttergottes mit dem Rauchmantel in der Ecke hat hier vielleicht einen kleinen «Schubser» gegeben. Und solche Schubser brauchen wir wohl auch immer wieder, denke ich: Schubser der Kreativität und des Glaubens und der Hoffnung – auch in Zeiten, die «Zerstörung und Krise» rufen möchten.
So schiele ich ab und zu auf unsere Muttergottes mit dem Rauchmantel und das kleine Mädchen mit dem Suppenteller von Toni. Sie zeigen uns einen ganz kleinen Weg der Hoffnung, der vielleicht ganz gross ist.
Euch allen wünschen wir einen guten Oktober und den Segen des Himmels und danken für alle Zeichen Eurer Solidarität
Eure Sr. Christina mit Sr. Michaela
Das Glück ist gekommen
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat
«Schwester Christina, da ist sie wieder, komm mal»! So ruft Schwester Michaela mich mit freudig liebevoller Stimme in den Korridor. Ich horche auf, verlasse kurz die Ambulanz. Schwester Michaela zeigt auf das Gemüse, das ein Patient gebracht hat und lächelt. «Guck!» sagt sie. Und da sehe ich sie auf einem Zucchini hocken und «anbeten»: Ihre Vordergreifer sind zusammengefaltet wie im Gebet und sie verbeugt sich grazil dazu - immer und immer wieder. Ästhetik, Schönheit, vollendete Anatomie im Zusammenspiel der Bewegung! Ich möchte gar nicht mehr weggucken. Schwester Michaela nimmt sie auf ihre Hand und sie betet weiter. Wir freuen uns. Jedes Jahr hatte wir eine Gottesanbeterin vor dem Haus - irgendwo in einem Blumenstock. Heuer fanden wir bislang keine – nun kommt sie durch das Gemüse - Geschenk eines Patienten - zu uns. Seitdem – es ist nun eine gute Woch eher – denke und meditiere ich über meine Anbetung Gottes. Und ich stelle fast beschämt fest, dass ich oft mehr anbettle als anbete. Und ich denke weiter an dieses grazile grasgrüne Tierchen und meine Gebetshaltung: Vielleicht bin ich erst wirklich in der Anbetung, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke – und eben einfach bin – wie sie?? Ich weiss es nicht, ich muss es auch nicht wissen. Aber es ist Glück, die Gottesanbeterin hin und wieder zu beherbergen - so denken wir, so fühlen wir. Und Sr. Michaela setzte sie sacht im Garten auf einen Strauch. Ihr Grün mutet mich belebend an – und steht im krassen Gegensatz zur langsam dürr werdenden Umgebung, im Schein der brennenden Hügel rings um uns rum. Ja, es brennt wieder an vielen Stellen in Albanien der Wald. Die Feuerwehren sind äusserst dürftig ausgerüstet und versuchen mit Stöcken, Hacken und Tüchern zu löschen; vielerorts sind die Bürger sich selbst überlassen. Und mein Blick geht in diesen Tagen besorgt in die nahen Hügel und sucht die Hänge ab. Und in der letzten Nacht hat das Feuer wieder gelodert – es hat sich die Tage über durch die Hänge gefressen und das Grün wie im dunklen Rachen eines Drachen verschluckt. Derweil brennt die Hitze erbarmungslos auf uns runter und lehrt uns das Bitten um Regen, das demütige Bewusstsein von der Abhängigkeit vom kostbaren Wasser und dem Geber dieser Gabe. Die Gottesanbeterin verbeugt sich mit ihren zusammengefalteten Vorder-greifern. Vielleicht müssen wir es neu lernen – durch Feuer und Hitze hindurch. So denke ich.
Und dann – am selben Abend, als die Gottesanbeterin uns aufgesucht hat, da kommt der Abraham und bittet, mit mir reden zu dürfen. Seit gestern ist er mit Sr. Michaela in der Rheinau für die jährlichen Arztvisiten. Leider sind die beiden nach zwei Tagen Fahrt mit Corona dort erkrankt und wir hoffen, dass sie sich bald erholen.
Aber nun zu Abri. Er sagt mir folgendes: «Du, Mom, ich habe jetzt viel über mein Leben nachgedacht. Jetzt weiss ich, dass das Glück zu mir gekommen ist, nicht ich zum Glück gegangen bin. Der Gott hat mir das Glück geschenkt, dass ich die ersten Tage überlebt habe, obwohl ich eigentlich schon fast tot war. Das weiss ich von innen raus so. Und das Glück des Lebens ist zu mir gekommen. Und ich weiss nun auch, dass es überhaupt nicht wichtig ist, ob ein Mensch laufen kann oder nicht laufen kann, wie ich zum Beispiel. Das spielt in deinem Leben überhaupt keine Rolle.» Wir redeten über eine Stunde über das Glück, das Leben haben zu dürfen. Ein Fünfzehn-jähriger im Rollstuhl in einem Land scheinbar ohne Perspektive, in ständigen Krisen, in brutaler Armut – er spricht glasklar und einfach wie der Bergbach im Dukagjin über das Glück des Lebens, das zu ihm kam. Irgendwie kann ich mich da nur stumm verneigen wie die Gottesanbeterin. Und mir kommt nur eines in den Sinn: GOTT! Ich kann dies schreiben, weil Abraham es mir erlaubt hat.
Und ein kleiner neuer Erdenbürger braucht dieses Glück, von dem Abraham «innendrin» weiss. Der kleine Blondschopf ist gerade mal 6 Wochen alt und hat schon viel durchgemacht. Wenn ich nun seine Geschichte erzähle, dann erzähle ich auch von einer wunderbaren Zusammenarbeit über etliche kurvige Höhenkilometer hinweg. Pater Andreas aus Fushe-Arrez hatte den Kleinen angekündigt, da die Eltern vorher dort gelebt haben und jetzt hier irgendwo im Tal oder in der Stadt ihr Glück versuchen möchten, was jedoch fast immer zum völligen Desaster wird.
Als die Eltern hierherkommen, ist sehr schnell für mich klar: Beide sind – sachte ausgedrückt – heillos überfordert mit der Situation und dem Baby. Ihr Kind hat eine seltene Darmerkrankung, die eine Teilresektion des Dickdarmes erforderlich gemacht hat und nun hat der kleine Mann einen sog. künstlichen Ausgang. Da sie sich nicht kümmern konnten, wie nötig, ist nun das gesamte Umfeld des künstlichen Ausgangs schwer entzündet und die Haut bereits defekt. Die Eltern haben kein Material, den Stuhlgang abzufangen, sie haben weder Kinderwagen noch Tragetasche noch genügend Kleidung, keine Windeln, einfach nix. Die Mutter kann nicht stillen. Sie haben die Milch vergessen und das Baby brüllt vor Hunger oder Durst. Als ich ihnen erkläre, dass bei dieser Hitze mit gerade 40 ° das Baby sehr schnell an Flüssigkeitsmangel sterben könne, da starren mich beide unverständig an. Ich nehme die leere Flasche und sehe, dass vergraute verschimmelte Milchreste von Tagen da drinhängen. Ich schlucke und bleibe ruhig und erkläre, wie und warum man die Flasche sauber halten muss. Und ich putze sie sauber. Dann erkläre ich weiter und zeige, wie das Baby am Wundfeld versorgt werden muss, auf was sie sonst noch bei der Pflege achten müssen usw. Sie hören zu, aber der Vater erklärt immer wieder, dass das alles zu schwierig sei. Feli rennt für mich rum und sucht, was wir noch brauchen. Ich lasse den Vater alles üben, da er aktiver scheint als die Mutter. Der Kleine hat Glück, dass er ein Junge ist. Was mit einem Mädchen wäre, darüber denke ich lieber gar nicht nach. Der Vater macht es erstaunlich gut und ich motiviere ihn. Wir richten Kleidung, Verbandszeug, Feli kauft schnell Babynahrung usw. Dann sagt der Vater doch prompt, dass er ins Ausland möchte. Ich rede ernsthaft mit ihm, versuche ihm, die Verantwortung für seinen Sohn klar zu machen und dass es besser wäre, in die Heimatregion zurückzugehen, wo sie wenigstens ein Feld zum Bebauen haben. Aber sie wiederholen, dass sie hier in der Stadt eine Wohnung suchen - die Mietzahlung steht jedoch in den Sternen. Das ist völlig utopisch. Ich erkläre von Neuem. Die Situation ist sehr schwierig, vor allem, weil das Baby in einem schlechten Zustand ist und ab jetzt nichts mehr schief gehen darf. Ich bläue vor allem dem Vater den kritischen Zustand seines Sohnes ein und vor allem appelliere ich massiv an seine Verantwortung als Vater dieses Kindes. Er verspricht mir, bei einem Freund in Shkoder zu bleiben, das Kind so zu versorgen, wie ich gezeigt habe und dann wiederzukommen. Ich spreche dann nach diesem Besuch umgehend mit Pater Andreas. Und Pater Andreas bestätigt die prekäre Situation der kleinen verwahrlosten Familie. Da hat er die Idee, dass er die Familie in einem Haus in der Nähe seines Klosters im bekannten Umfeld unterbringen könnte – mit einigen klaren Bedingungen und unter Anleitung für das Baby und den Haushalt. Es gibt Hoffnung. Und so sind die Eltern nun nach Fushe-Arrez zurückgekehrt und Lukas und ich sind gestern nochmal dorthin kutschiert und haben den kleinen Riegers nochmal angeguckt. Die Eltern haben das gut gemacht und die Wunde ist etwas abgeheilt. Der Kleine hat zugenommen und Sr. Gratias wird das Baby nun weiter angucken und wir hier unten im Tal sind jederzeit «griffbereit». Pater Andreas wird sich um den Vater kümmern. Wir hoffen, dass er die Verantwortung für seine kleine Familie begreift und sich einigermassen stabilisiert. Aber vorerst haben wir da noch einige Fragezeichen. In solchen Fällen, die leider keine Einzelfälle hier sind, denke ich manchmal fast ein bisschen neidisch an das soziale Netz in der Heimat, wo man nicht so durch die Maschen fällt. Hier gibt es nicht mal «Maschen», weil es kein wirklich funktionierendes soziales Netz gibt. Man ist sich schlichtweg selbst überlassen. Und ein Kinderheim wäre völlig überfordert mit dem Baby. Umso dankbarer bin ich für dieses «Klosternetz» mit der Schwester und den Brüdern in Fushe-Arrez. Wir bauen weiter daran.
Ja, zur Sozialen- und Gesundheitsversorgung hier noch eine kleine Begebenheit, die mich nachdenklich macht: ein Mann aus dem Gesundheitsbereich hat seinen Bruder mit einer versauten Fusswunde (Diabetiker) hierhergebracht. Wir versorgten ihn. Beim dritten Mal schien der Mann mir sehr anders, traurig und irgendwie «daneben» zu sein. Ich fragte ihn nach seinem Befinden und da legte er los und es brach aus ihm raus: «Schwester, es geht mir gesundheitlich gut. Aber schon seit ich das erste Mal mit meinem Bruder hier war und Euch zugeschaut habe, seitdem, da geht es mir seelisch immer schlechter. Und ich frage mich Tag und Nacht, wie es möglich ist, dass Ihr so gut mit den Patienten umgeht, so umsichtig und menschlich. Das könnten wir doch auch. Aber bei uns da ist es brutal. Und ich verstehe jetzt, dass man es anders machen kann. Können Sie uns das nicht beibringen?» Dann weinte er glatt. Ich vereinbarte mit ihm, dass wir im Gespräch bleiben können, da er ja einen Job in diesem System habe. Mal gucken, ob er im September hier auftaucht oder es hinter sich gelassen hat.
Ich möchte nun nicht versäumen, Euch allen noch gute Sommertage zu wünschen. Und wir sagen Euch allen «Vergelt`s Gott» für alles Wohlwollen, für jegliche Hilfe, die uns so ständig gegeben wird. DANKE. Es ist auch ein grosses Glück, um Euch alle wissen zu dürfen.
Mit herzlichem Segensgruss
Sr. Christina

Der Mohn gehört der Schlange
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat
Hinter uns liegen ein paar intensive Wochen und wir stellen wieder einmal fest, dass Langeweile nicht unser Hausgast ist. Oft auch in diesen Wochen denke ich an Euch alle, die Ihr uns so unterstützt, in welcher Weise auch immer. Dafür möchte ich explizit DANKE sagen. Es ist wie frischer Rückenwind für uns, wie das Wehen des guten Geistes, der uns anhaucht, manchmal auch antreibt. DANKE für jedes wohlwollende Denken an uns, jedes Gebet, jede Hilfe, jede Zeit, jede Arbeit für uns hier. Und so erzähle ich, was so «rundrum» gerade los ist.
Ja, es blüht wieder der blutrote Klatschmohn wild auf den Feldern und Hängen. Manchmal weht der Mohn mir die Schwermut der Ukraine zu – das Blutrot lässt mich an die Schwestern und Brüder denken, die dort jeden Augenblick ihr Leben lassen. Und ich frage eindringlich den Mohn, ob er keine Botschaft des Lebens habe. Die blutroten Blüten wiegen im Wind und es quillt das Leben aus den Blüten – auch blutrot. Ich muss selbst abwägen, welche Botschaft der Mohn für mich hat. Und ich weiss, dass er mich auch zwischendurch um vergossenes Blut trauern lässt – sei es dort im Krieg und hier in der Blutrache. Und der rote Mohn hier ist von einem Mythos umgeben, der uns vor ein paar Tagen erzählt wurde. Ich bekam einen Strauss dieser roten Blumen geschenkt und arrangierte ihn am Gang. Eine Mitarbeiterin kam und sagte: «Schwestern, die Mohnblume gehört der Schlange, die dürfen die Menschen nicht haben.» Ich fragte: «Vitore, und wer sie pflückt, was geschieht mit dem?». Sie sagte kategorisch: «Man darf sie nicht pflücken, denn es sind die Blumen der Schlange!» Mehr Erklärung war ihr fremd - sehr fremd. Was der Schlange gehört, das ist TABU. Ohne Warum. Ich habe verstanden – wieder einmal viel verstanden. Und so gehört der Mohn der Schlange und die Schlange vielleicht ja auch zum Mohn – wie das Blut zum Krieg und zum Leben. Aber ich sehe noch die flackernde Angst in den Augen von Vitore, die Angst, dass uns jetzt das Unglück treffen wird, da wir der Schlange den Mohn geraubt haben.
Das Leben ist in diesen Tagen hier noch schwerer geworden für die Armen. Der Krieg raubt den Armen das letzte Stück Brot. Heute waren zwei Bedürftige vor unserem Tor, die völlig abgemagert waren. Beide haben nicht mehr genug zum Essen, da die Preise so sehr gestiegen sind, dass es für nötige Ernährung nicht mehr reicht. Sie baten um Lebensmittelhilfe. Vor unserem Tor werden es jeden Tag mehr Bittsteller. Wir tun, was wir können. Und wir sind froh, dass einige Obstbäume haben, die Gärten bald Früchte tragen. So ist es wenigstens für die Leute auf dem Land leichter, die Kinder durchzufüttern. Die Städter in Shkoder trifft es härter. Vor allem ältere Menschen verarmen völlig; die Renten gibt es nicht oder sie reichen einfach nicht mehr für das Nötigste. Und dennoch bringen uns die Patienten das letzte Ei, die ersten Kirschen, um sich zu bedanken. Es ist uns oft arg, da wir wissen, dass sie selbst nicht genug haben. Aber es ist diesen Menschen so wichtig, etwas dazulassen. Es ist, als gäbe es ihnen Würde und es ist gut so.
Ich muss noch etwas erzählen, was mich einfach bewegt. Ich hatte einen Patienten, der nicht ganz einfach ist, eher zu den verschlossenen Menschen gehört und eher misstrauisch und mürrisch durchs Leben geht.
Vor einigen Tagen konnte ich ihn entlassen; die Wunden waren geheilt. Er guckte mich an und sagte: «Schade, ich werde sie vermissen - daheim habe ich nur meine Katze, mit der ich reden kann. Schwester und ich habe was gesehen: ihre Seele lacht immer». Mit diesem Satz ist mir ein «Amanet», ein besonderes Vermächtnis, gegeben.
Und dann ist da noch ein Wunder, das ich erzählen möchte. Unser schwer verbrannter Andi ist in Zürich im Kinderspital! Dies haben wir in keinster Weise erwartet und nicht mal zu träumen gewagt. Wie es dazu kam: die Verbandswechsel bei Andi sind immer mehr zum Drama geworden, die Wundheilung ging nur schleppend. Ich wagte es, im Kinderspital in Zürich in der Brandstation um Rat zu fragen, schickte ein paar Fotos. Und wunderbare Menschen dort haben uns ermöglicht, dass Andi nun dort behandelt werden kann. Es war ein Wettlauf, auch mit unserer Nervenstärke: Pässe für Andi und die Mama mussten schnellstens besorgt werden, die gesamte Bürokratie für eine Ausreise ist hier ein Abenteuer. Wir mussten Klamotten richten, Koffer packen. Dann der Transfer: Schwester Michaela und Felicitas erklärten sich bereit, mit dem Kleinen und seiner Mama mit dem Auto einfach durchzufahren. Die Mitschwestern in der Schweiz erklärten sich auch bereit, alle zu unterstützen und zu empfangen. Das Auto wurde zur fahrenden Ambulanz eingerichtet. Dann – am Abend vor der Abreise - bekam der Vater von Andi die Panik und hat beschlossen, dass er jetzt seinen Sohn mit Naturmitteln behandelt. Er hat uns angerufen, dass alles annulliert sei und sich für alle Bemühung bedankt. Er hat mir noch gesagt, dass er seinem Sohn jetzt eine wunderbare Salbe auf die Wunden geschmiert hat und er auch keinen Verband mehr braucht, da es an der Luft heilen muss. Wir waren alle wie vom Blitz getroffen. Ich rief ab 21:00Uhr sicher zehnmal an, aber erfolglos. Die Mutter hatte sich zu fügen und fügte sich. Diese Nacht werden wir wohl lange nicht vergessen. Die Achterbahn unserer Gefühle auch nicht. Wir sahen keine Chance, etwas daran zu ändern. Und wir wussten, dass Andi daheim vermutlich an einer schweren Infektion sterben würde. Ich spürte eine lange Nacht meine gebundenen Hände. Irgendwann sagte ich mir, (oder dem Vater) «Ok, dann halt nicht, es ist dein Sohn - wir haben es leichter, wenn wir das alles nicht durchziehen müssen und sparen uns einen Haufen Geld, das wir eh zusammengekratzt haben.»
In der Früh um 6.30 Uhr kam der Abraham und sagte mir: «Du musst es unbedingt nochmal bei Andis Vater versuchen. Du musst es schaffen. Er muss in die Schweiz, sonst stirbt er!»
Ich spürte einen Anflug von Rebellion in mir: «Abri, wir haben alles versucht - er hat sich anders entschieden!» Dies wollte ich schon rausblasen. Aber ich sah in die Augen von unserem Abri, in das selbstverständliche Wissen, dass ich darin las wie in einem Buch: «Christina, klar Du wirst das nochmal versuchen, du kannst doch kein Kind einfach so lassen, wenn ein Vater daneben ist…der Andi der muss in die Schweiz..» Und so nahm ich das Handy wie automatisch in Allerfrühe und legte nochmal los. Nach zwei Stunden konnten wir den Andi und seine Mama abholen. Er stand dann bei uns im Korridor mit nacktem Oberkörper, die schweren Wunden ohne Verband, die Natursalbe tropfte runter. Um 9.30 Uhr war dann Andi verbunden und im Auto gelagert und Sr. Michaela mit ihrer Engelsgeduld, Felicitas mit ihrer Ausstrahlung von Ruhe und der Andi mit der verängstigten Mama fuhren los Richtung Zürich.
Inzwischen ist Andi operiert, wenn es auch einige Turbulenzen mit dem jungen Mann gegeben hat. Wir können nur allen danken, die da sind für ihn, die sich kümmern und auch finanziell helfen. Und wir hoffen, dass Andi genesen kann.
Neben dem roten Mohn zeigt sich hier die Natur in der Fülle einer Blüte, wie ich sie selten sah. Es hat ein paarmal geregnet und ich staune jeden Tag über die Schöpfung. Gestern Nachmittag trieb es mich raus und Lukas und Donata fuhren spontan mit in die nahen Hügel.
Während Schwester Michaela hier die uns geschenkten Kirschen zur süssen Marmelade kochte, wollten wir wilden Salbei sammeln. Es waren ein paar wunderbare Stunden. Die wilde Vielfalt in den Hügeln und zwischen den Felsen ist ungebrochen. Wir fanden eine Vegetation mit rosa Freesien und Orchideen, grossem Zittergras und wundersamen Disteln. Donata rutschte raus: «Das ist ja schon fast magisch!» Und dann stieg uns der Geruch von Salbei in die Nase: stark und in die Berge gehörend! Diesen Salbeigeruch kann man nicht in der kultivierten Pflanze schmecken. Dafür muss man in die albanischen Berge. Fast feierlich nahmen wir einige Blätter zum Trocknen mit. «Die Heilpflanze muss dort bleiben, wo sie der Schöpfer hingestellt hat.» Dies sagte uns dort ein Einheimischer, der uns eine traurige Geschichte erzählte. Wir trafen ihn, als wir am Hang zwischen den Steinen rumhüpften. Ich begann ein Gespräch mit ihm und er erzählte uns die Geschichte von seinem Dorf:
Das Dorf ist leer. Vor noch zehn Jahren haben alle Dörfler vom Verkauf der Salbeiblätter gelebt. Sie hüteten die Pflanzen – sie wussten, dass Plündern alles zerstören würde. Dann kamen die Leute vom Tal unten. Und die haben die meisten der Pflanzen mit den Wurzeln ausgerissen und ins Tal verpflanzt – zum Kultivieren. Die Dörfler waren ruiniert und die meisten mussten weggehen. Wir sahen einige Salbeipflanzen nachwachsen. Und ich sagte dem Mann, dass die Natur sich vielleicht erholen könnte. Er solle sie schützen. Ob er Hoffnung hat? Ich weiss es nicht. In jedem Fall werden wir nochmal dorthin gehen. Vielleicht ist der Mann dann wieder da und lebt dort weiter in diesem Dorf. Der Salbei gehört dem Berg. Und der Mann sagte noch: «Unser Salbei vom Berg kann dort unten nicht heilsam werden. Er hat keine Kraft da unten. Der Salbei gehört in den Stein!»
Und ja: der Mohn gehört der Schlange!
Und wir grüssen Euch sehr herzlich vom Klösterle in Dobrac, wohin wir gehören
Sr. Christina mit allen hier

Hoffnung findet Wege
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat,
wenn gerade die Herbstsonne ihre schon längeren Schatten wirft, dann wird es mir bewusst, dass ein Vierteljahr seit dem letzten Rundbrief vergangen ist. Gerne melde ich mich wieder. Wahrscheinlich könnte ich über die letzten Monate ein dickes Buch schreiben.
Es würde den Titel wie oben haben: «Hoffnung findet Wege oder sucht Wege!»
Ich möchte Euch nicht verschweigen, dass wir drei schwere Monate hatten. Seit Dienstag, also vier Tage nun, atmen wir auf. Unsere treue, selbstlose Irena war anfangs Juli am falschen Platz und am falschen Ort. Sie wurde von uns im Dienst dorthin geschickt. Und sie wurde verhaftet – und hat nun drei Monate im Untersuchungsgefängnis verbringen müssen. Die Zeit dazwischen ist schwer in Kürze zu beschreiben: «Sorge um Irena, Wut, Hilflosigkeit, Suchen nach Lösungen, Hoffnung auf sofortige Freilassung, Begraben dieser Hoffnung und wieder neue Hoffnung bis zum nächsten Verhandlungstermin, nicht zuletzt auch die Auseinandersetzung mit meinem Schuldgefühl, dass sie für mich da «einsitzt». Für mich war schwierig, einfach keinen Zugang zu ihr zu bekommen, ich konnte nur einige Male ganz kurz mit ihr telefonieren. Besuchserlaubnis erhielt ich nicht.
Da die Post nicht so funktioniert und geschlossene Brief nur per Post ausgehändigt werden, habe ich das «Tagebuch von Anne Frank» in albanischer Sprache gekauft und in Anne’s Eintragungen einige Gedanken von mir für Irena handschriftlich zugefügt. Irena sagte nun, dass sie dies alles miteinander (mit Zimmergenossinnen) gelesen haben. Niemals hätte ich gedacht, dass ich jemals in so einer Situation sein würde.
Die Mitarbeiterinnen hier hat es stark mitgenommen, aber diese Zeit hat uns alle auch noch mehr zusammengeschweisst. Ein Geschenk in dieser Zeit hat mir der Himmel gemacht: ich konnte mich irgendwie zu GOTT durchwühlen und das innere Wissen bekommen, dass, trotz allem, GOTT da ist und «nichts, aber auch gar nichts, uns alle von SEINER Liebe trennen kann – auch die grösste Ungerechtigkeit nicht. Aber ich gebe zu, ich wühlte mich da durch, wie so ein Maulwurf, der seinen Gang durch die dunkle Erde buddeln muss. Und ab und zu bin ich mit meiner Maulwurfnase schwer angestossen. In diesen Zeiten war ich umso dankbarer für Sr. Michaela, ihre Sicht, ihre Gefühle, ihr Dasein. Wir sind froh, dass wir uns gegenseitig haben. Dies ist uns in diesen drei Monaten wieder auf ganz andere Weise gezeigt worden. Wir durften diese Herausforderung bestehen, wenn wir auch Blessuren haben, die noch Zeit brauchen. Und Irena ist nun daheim, wenigstens raus aus dem Untersuchungsgefängnis. Es geht ihr gut; sie braucht aber Zeit. Was wir jetzt schon wissen: Sie war in ihrer Zelle die Mutter und die Freundin und die Trösterin der anderen. Das erste, was sie sagte, als sie uns am Mittwoch dann begegnete: «Ich möchte bitte Kerzen anzünden für jene, die ich dort zurückgelassen habe; ich habe ihnen das versprochen und auch mein Gebet!» Das ist Irena. Sie sagte uns dann noch, dass sie jeden Abend in ihrem Loch ein Gebet zu Gott geschrieben hat. Wir haben dann ein wenig miteinander geweint. Nun haben wir sie wieder und irgendwie kommt es mir noch ganz unreal vor, als wäre ihre Präsenz nicht wirklich, eher ein Hauch von ihr, der schnell wie entgleitet. Und das Leben hier ist weitergegangen, die Tage sind nach dem Urlaub im August den längeren Abenden entgegengeflogen. Und sie waren und sind gefüllt von viel Not und steigender Armut und gleichzeitig von der Hoffnung der Menschen, bei uns ankern zu können. Leider ist die Coronasituation hier sehr prekär geworden. Eben kam Sr. Michaela und erzählte, dass ein jüngerer Polizist, den wir auch kennen, daran gestorben ist. Gleichzeitig traf sie unseren Trinkwasserlieferer, der dann mitteilte, dass seine Mutter an Covid nun verstorben sei. Wir lieferten noch ein Krankenbett von uns, bevor sie ins Spital überwiesen wurde und dann dort gestorben ist. Es sind jeden Tag neue Familien aus unserem Wohngebiet, die das Virus haben und denen es teilweise sehr schlecht geht. Wir bringen Lebensmittel, Hygieneartikel, Desinfektion und kaufen die notwendigen Medikamente. Die Angst geht nun um; die meisten sind nicht oder noch nicht vollständig geimpft. Wir hoffen und beten und tun, was wir können. Die ökonomische Situation hat sich die letzten zwei Wochen enorm verschlechtert, da die Preise für Grundnahrungsmittel wie Mehl, Reis, Speiseöl enorm gestiegen sind. Gemüse und Obst ist nicht mehr erschwinglich. Gemüseskandale wie z.B. mit längst verbotenen Pestiziden verseuchte und nun aus dem Verkehr genommenen Tomaten, machen das Ganze zur vollen Misere. Dazu kommt noch eine angekündigte Preissteigerung für Wasser, Strom und Gas. Die meisten Menschen hier wissen nicht mehr, wie sie diesen Winter überstehen sollen. Sie denken nur noch an eines: nichts wie raus aus diesem Land. Dazwischen sind dann noch wir wie so ein flackernder Leuchtturm im Sturm. Ja, sie kommen nun in Haufen, in Scharen, in Verzweiflung und mit Hoffnung. Schwester Michaela hat schon begonnen, die noch nicht verteuerten Makkaroni aufzukaufen, damit wir diese verteilen können. Dank sei Gott können wir unsere Kinder im Kindergarten jeden Tag mit gutem, vitaminhaltigem Essen versorgen.
Täglich werden wir zu Kranken in den Häusern gerufen. Die verfaulen in den Betten und sind allein gelassen. Wir müssen eine Art häusliche Krankenpflege aufbauen. Wir können das selbst nicht mehr stemmen, da die Menschen aus allen Himmelsrichtungen zu uns kommen. Die ersten Gespräche sind geführt, da die weiteren Anfragen diesbezüglich auch von zwei Priestern aus umliegenden Gemeinden gekommen sind. Es ist gut, wenn das Blickfeld soweit ist, dass die Notlage erkannt ist und die Pflegbedürftigen langsam aus der Tabuzone in das Lebensumfeld rücken. Wo der Leidensdruck nicht die Depression, sondern gutes Hinter-fragen und Aktivwerden fördert, da besteht Hoffnung auf anhaltende Kreativität zur Änderung. So stehen nun in diesem Monat die ersten Gespräche zur Realisierung der Hilfeleistung bevor. Ich bin schon gespannt und auch voller Tatendrang. Die Alten und Schwerkranken liegen uns sehr am Herzen, manchmal auch ein paar Nächte lang im Magen.
Da muss ich eine Erfahrung erzählen, die mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat. Es ist jetzt keine so ästhetische Begebenheit: Ich wurde von einer jungen Schwester aus einem anderen Orden gebeten, mit ihr eine Schwerkranke zu besuchen, weil sie mit dieser Frau nicht weiterwisse, wie sie sagte. Sie sagte mir am Telefon nur, dass es einfach schrecklich wäre dort und ich bald kommen sollte. Ich vereinbarte mit ihr am selben Nachmittag einen Besuch. Was ich dann erlebte, war eine der heftigsten Krankenbesuche, die ich bislang gemacht habe: eine etwas übergewichtige alte Frau lag auf einem gestickten, verdreckten Sofakissen auf der Seite auf einem alten Bettgestell. Die stark angeschwollenen und aufgeplatzten Beine lagen schräg ausserhalb des Bettes auf einem Holzstuhl. Das Wundwasser tropfte runter. Als ich sie mit ihrem Namen ansprach, drehte sie sich langsam zu mir um und ich blickte in ein Blut verschmiertes Gesicht, das heisst, Blutkrusten verklebten ihr Gesicht. Das ganze Bett war voll mit Blut verschmierten Lumpen, überall war altes verschimmeltes Essen und es roch nach Urin und Blut und Fäulnis. Ich kam vor lauter Unrat nicht durch, um das Fenster zu öffnen. Die Tochter, die da war, sagte mir, dass sie selbst schwer depressiv sei und sie sich nicht um die Mutter kümmern könne. Seit zwei Tagen hatte die Frau schwere Blutungen aus Mund und Nase. Das Blut liess sie sich nicht wegwischen. Einen Arzt sowie die Einweisung ins Krankenhaus verweigerte sie aus Angst, dass sie dort von Corona angesteckt werden könnte. Ich vermutete allerdings bei ihr selbst Corona. Sie hatte schwerste Atemnot und auch Fieber. Sie verweigerte mir auch, sie zu waschen usw. Wir konnten mit ihr vereinbaren, dass die Vinzentinerin mit einer Frau zuerst mal das Zimmer ein wenig in Ordnung bringen wird. Ich versprach ihr, eines unserer Pflegebetten für sie zu organisieren. Es war in diesem Zimmer jedoch keinerlei Platz für dieses. Ich entdeckte eine zweite Tür am Gang und fragte, ob dieses Zimmer denn für das Bett Platz habe. Da erreichte mich ein schriller Schrei aus dem Krankenzimmer. Die kranke Frau verbot mir mit aller Kraft, dass ich in dieses Zimmer trete. Der schrille Schrei dieser mit Blut verschmierten, völlig atemlosen und entkräfteten Frau sitzt mir noch heute in den Gliedern. Ich ging zu ihr zurück und fragte vorsichtig, was es denn mit diesem Zimmer auf sich habe. Da sagte sie folgendes – mit sichtlicher Angst: «In diesem Zimmer lebt die Seele meines Mannes; er ist dort gestorben!» Ich konnte mich nicht setzen, da alles so verschmuddelt war. Aber jetzt rang ich irgendwie auch nach Atem oder ich brauchte eine Atempause, um gut reagieren zu können.
Ich fragte sie dann ein wenig nach ihrem wohl vor Jahren verstorbenen Mann und ging langsam das Thema nach der Öffnung des Zimmers an. Ich sagte ihr auch, dass ich sicher sei, dass ihr Mann seinen Frieden gefunden habe und seine Seele nun frei sei. Sie willigte ein, dass ich die Tür öffne und reinschauen kann. Aber sie erklärte mir nochmals mit aller Kraft, dass sie niemals in dieses Zimmer gehen werde. Nun, ein Schritt der Annäherung an das Seelengespenst des verstorbenen Mannes war damit getan. Sie hatte die Tür auch zu ihrer verbarrikadierten Seelen-Angst einen kleinen Spalt geöffnet. Was ich dann sah und vor allem roch, das war dann schon eher wieder gespenstisch: Das Totenbett war noch so, wie vor Jahren, aber alles vergärt, verschimmelt. Der Gestank wurde von einem Eimer voller verfaulten Zwiebeln dann noch gesteigert. Ich lief raus auf den grauen, tristen Gang des Blockhauses und lehnte mich über das Treppengeländer. Dieser Besuch schreit mir die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer organisierten ambulanten Betreuung der Kranken und Alten förmlich ins Gesicht.
Und da kommt in diese Not der Menschen dann einfach Hoffnung: da machen sich Leute wie die «Bullis», trotz Corona, auf den Weg und bringen Hilfsgüter. Sie laden nicht nur ab - sie interessieren sich für die Menschen und uns. Da kommen Pakete, da kommen Praktikanten, um uns ganz praktisch zu helfen, da wird für uns gebetet, da wird organisiert und gefragt, wie es uns denn geht. Und da haben Geschäftsleute aus meiner Heimatstadt ihre Kleider, die wegen Corona nicht verkauft werden konnten, nicht einfach entsorgt. Diese neuen Kleider haben wir nun bekommen. Diese Solidarität ist Hoffnung. Es wäre einfacher gewesen, diese Kleider zu entsorgen. Viel Einsatz von ganz vielen Leuten hat es gebraucht, diesen Transport zu ermöglichen. Wir sind unglaublich dankbar und gerade am Verteilen. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie glücklich die Menschen hier sind, einmal ein neues Kleidungs-stück anziehen zu dürfen. Eine junge Frau hat mir geschrieben, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil sie die Hose und den Pullover nicht mehr ausgezogen hat.
Und die kommende kalte Jahreszeit mit weniger Strom und Licht und Wärme wird leichter, weil eine warme neue Jacke wärmt. Wir können Euch allen nur danken für jegliche Form Eurer Unter-stützung, sei diese materiell oder menschlich und spirituell. DANKE. Gott segne Euch alle
Sr. Christina und Sr. Michaela

Münsterlauf 2022
Am Freitag, 30.09.2022 findet von 19:00 bis 21:00 Uhr der traditionelle Münsterlauf statt.
Eine Anmeldung ist jederzeit vor Ort am Liebenfrauenmünster möglich.
Segensgruß
Liebe Schwestern und Brüder in meiner Heimat
Die letzten Tage war ich viel in Gedanken und in den Gebeten in meinem Heimatland.
Wir haben die Nachrichten und furchtbaren Bilder der Flutkatastrophe gesehen und wir alle im Klösterle sind in diesen Tagen wirklich mit unseren Gedanken und vor allem mit unseren Gebeten bei Euch allen. Die Menschen hier wissen, was es bedeutet, ohne menschliche Sicherheit den Gewalten ausgeliefert zu sein und sind deshalb auch mit ganzem Herzen irgendwie dabei. Oft kommen die Mitarbeiter oder auch Patienten und fragen, wie es den Deutschen jetzt geht, ob Ihr alle heil seid und ob sie helfen können.
Und so fühlen alle mit Euch in dieser Situation. Und natürlich hoffen wir, dass Ihr alle heil geblieben seid.
Gott schütze Euch alle und der Glaube und die Hoffnung stärke vor allem jene, die betroffen sind. Wir beten.
Im Extrem leben
Liebe Schwestern und Brüder
Die Ruhe der letzten Monate war trügerisch. Vielleicht bin ich einer schönen Illusion erlegen. Vor einer Woche noch dachte ich erleichtert: «Sie sind anders geworden, sie haben es verstanden; wir können diese Arbeit bald aus unserer Agenda streichen.»
Aber ich bin nun unterwegs im Auto, um meine Illusion von der bitteren Realität zerstören zu lassen. Blutrache! Es hat uns wieder eingeholt. Ich bin unterwegs zu einer Familie mit sieben halbwüchsigen Kindern. Seit 10 Tagen « stehen sie unter dem Blut». Und die gesamte männliche Verwandtschaft. Der Vater hat einen jungen Mann auf der Strasse erschossen. Der Sohn einer Mutter, der gerächt werden muss!
Und die Eingesperrten haben nichts mehr zu essen und baten über Mittelsleute um Lebensmittel. Das Unglücksrad dreht sich wieder. Mir ist schon den ganzen Tag etwas mulmig in der Magengegend. Ich weiss schon länger, dass ich dort hingehen werde. Und es hat sich auch bei mir nichts geändert: immer noch bin ich angespannt, immer noch bin ich am Ordnen und Orten meiner Gefühle, die sich einpendeln müssen, damit ich auch fair mit der Familie, die jetzt Opfer ist, umgehen kann. Immerhin hat der Vater einen jungen Mann erschossen. Motiv: «Beleidigung auf der Strasse und Streit und Schlägerei mit einem der Söhne, ständige Belästigung vor dem Haus.» Ich bin in einem Haus eines Mörders und alle rechtfertigen hier die Heldentat des Vaters und gleichzeitig hocken da vor mir jetzt dann Opfer von Blutrache. Ich weiss, dass der Rest der Familie nun den Kopf für den Vater hinhalten muss.
So fahre ich los. Schwester Michaela gibt mir noch den Segen. Unterwegs bete ich den Rosenkranz. Was sollte ich auch anderes tun, als die Hilfe des Himmels herbeirufen. Die Familie weiss nicht, dass ich komme. Ein Mitarbeiter fährt mit seinem Auto vor, er weiss, wo die Familie in einem anderen Teil von Shkodra wohnt. Wir vereinbaren unseren Treffpunkt an der Kiri-Brücke. Ich warte auf ihn und gucke ins ausgetrocknete, wilde Flussbett der Kiri. Wie viele Regimegegner wurden hier am Fluss erschossen und eingegraben. Der Fluss ist ihr Grab geworden. Dann kommt Niko. Wir vereinbaren, dass er gleich weiterfährt, nicht wartet. Diesen Gang muss ich alleine machen, da wir nicht wissen, wie die Rächerfamilie reagieren wird und ich den Mitarbeiter nirgends mit reinziehen möchte. Es ist uns beiden klar, dass die Buschtrommeln gut funktionieren und es im Nu bekannt ist, dass ich diese Familie, die unter dem Bann des Blutes steht, besucht habe. Erstmal fahre ich hinter Niko her durch das Dorf. Schlaglöcher sind zu umfahren. Dann biegen wir ab Richtung Nord-Ost in die Hügel. Es ist idyllisch, dass es fast weh tut: direkt vor mir grüne Hügel, der Ginster blüht noch überall. Im Bach fliesst noch Wasser vom vergangenen Gewitter, im Bachbett wachsen Mohrkolben. Ein leichter Wind im Olivenhain säuselt eigentlich die Botschaft vom Frieden. Eine Frau in albanischer Bauerntracht weidet ihre Kuh auf der Wiese, ein paar Jungs sind auf der Jagd nach Fröschen. Es ist schön hier, die Westler würden sagen: ein unberührtes Biotop. Nicht mal der sonst allgegenwärtige Müll ist hier zu sehen. Auch Corona scheint hier weit weg gewesen zu sein. Dann ruft mich Niko, der immer so 100 Meter vor mir fährt an und sagt, dass nun linkst das kleine Haus «das ist, nach dem ich suche». Er fragt noch vorsichtig, ob er nicht doch irgendwo in den Büschen auf mich warten soll. Ich verneine und sage ihm, dass ich mich melde, sobald ich wieder daheim bin. Ich parke das Auto – wie immer bei solchen Besuchen -in «Abfahrtsstellung». Man könnte auch sagen: in Fluchtrichtung» bemerke ich bei mir selber und grinse mir selber zu. Die Haustüre des kleinen Hauses mit Flachdach ist keine 10 Meter vom öffentlichen Weg entfernt. Die wackelige Gartentür ist auf, der Haus-hund schlägt sofort an, als ich das Holzgatter in die Hand nehme. Vorsichtshalber bleibe ich an der Strasse und rufe den Namen der Frau. Es dauert etwas, dann schaut sie aus der Türe. Ich sage, wer ich bin und ob ich eintreten darf. Sie sagt sofort JA. Mir wird das Sofa ange-boten und ich nehme Platz. Etwas stockend beginnt das Gespräch. Dann kommen drei jugendliche total hübsche Mädchen, die Töchter. Als ich nach den Söhnen frage, sagt mir die Mutter, dass alle zwei Tage nach der Tat, also vor einer Woche abgehauen sind. Wo sie sind, sagt sie mir nicht. Sie sagt, sie wisse es nicht. Mir ist klar, dass sie mir dies beim Erstbesuch nicht sagt, sie aber sicher weiss, wo ihre drei Söhne sind. Ein anderer Sohn ist seit vier Jahren im Ausland. Um den hat sie erstmal keine Angst, meint sie. Der Mann ist im Gefängnis in Untersuchungshaft.
Sie zeigt sofort auf die Fenster und sagt: «Wir sind schutzlos, wir haben keine Gitter und von der Strasse aus kann man uns beim Essen hier erschiessen.» Sie weiss zwar, dass Mädchen nicht ihr Blut geben müssen, aber die Angst ist trotzdem da. Der Vater ist im Gefängnis. Andere habe für ihn ausgesagt, dass er sozusagen keine Schuld hat, dass er zum Schiessen gezwungen wurde. Viele Gründe im Kanun sprechen für dieses Recht auf Tötung. So versucht mir die Frau zu erklären. Ich erreiche wenigstens, dass sie einsieht, dass es ein grosser Fehler war, da jetzt die gesamte Familie unversorgt ist. Der Vater war Alleinverdiener als Tagelöhner auf dem Bau in Montenegro. Die kleinste Tochter mit 15 Jahren ist traumatisiert. Sie hat die Bluttat vor dem Haus gesehen. Sie kommt nicht klar und schläft nicht mehr. Auch hat sie grosse Angst um ihre Brüder. Wie sie mit dem Vater, der geschossen hat zurechtkommt, das ist eine ganz andere Frage. Die Situation ist prekär. Zur psychischen Stresssituation kommt nun auch die wirtschaftliche prekäre Lage. Sie waren vorher schon arm. Der Rechtsanwalt wird Unmengen verschlingen, es ist fraglich, ob die Mädchen weiter in die Schule gehen können. Die Mutter sagt, dass die Jungs bei Freunden untergekommen sind, aber sie dort sicher nicht lange bleiben können. Ich vermute, dass die drei Brüder versuchen, irgendwie ins Ausland zu kommen. Für die illegale Ausreise brauchen sie viel, viel Geld. Ich bringe erstmal Lebensmittel und Hygieneartikel. Bislang war noch niemand bei ihnen. «Keiner, keine!» sagen sie und gucken ins Leere. Verzweiflung, diese schreckliche Verzweiflung der nun Isolierten und auf die Kugel Wartenden liegt in der schwülen Luft des kleinen Hauses, auf dem nun der Fluch des Blutes liegt. Die Isolation ist wohl das Schlimmste. Das spüren sie jetzt, obwohl es auf der anderen Seite in diesem Fall heisst, dass das gesamte Dorf eigentlich ganz froh ist, dass der Störenfried nicht mehr unter ihnen ist. Es geht nach der alten Tradition einfach nicht, dass ein Junge «daneben» ist, soziale Probleme hat und provoziert mit einem Motorrad, das er halt vor dem Haus immer wieder rasant aufbrausen liess.
In diesen Sekunden fällt mir absurderweise ein, dass nun viele ausländische Touristen hier im Lande sind, weil es so viel wie keine Corona-Massnahmen mehr gibt, die das Leben einschränken und isolieren. Sie geniessen die Freiheit in Albanien. Es zerreisst mich fast, so absurd finde ich die Situation. Aber ich bin dann gleich wieder präsent und frage nach der Familie des Opfers. Da ist nur noch die Mutter. Der Vater des Ermordeten starb schon lange. Der Bruder ist viel älter und lebt im Ausland. Er kam direkt nach dem Mord und lehnt jedes Zeichen der Entschuldigung ab. Er lehnte die Zulassung eines Familienmitgliedes des Täters zur Teilnahme an der Beerdigung kategorisch ab. Dies ist nach dem Kanun ein Zeichen der «Nicht-Versöhnung». Er hat den gesandten Männern den Eintritt ins Haus nicht erlaubt, sondern ausrichten lassen, dass es keine Chance auf «Besa» und auf Versöhnung gibt. Ich frage vorsichtig an, ob ich den Kontakt zur Familie des nun potentiellen Rächers herstellen kann. Die Mutter nickt. Wir vereinbaren jedoch, dass ich noch etwas warte; der Sohn wurde erst begraben. Da die Familie katholisch ist, frage ich sie, ob sie einen Rosenkranz haben möchten. Sie nehmen diesen gerne und ich bitte sie, für ihre Situation zu beten. Sie nicken irgendwie erleichtert, überhaupt was tun zu können. Dann lasse ich meine Handynummer bei ihnen. Sie sind auch darüber froh. Isolation und Ächtung müssen irgendwie durch-brochen werden. Ich werde wiederkommen.
Kaum einige Stunden daheim steht da unser Lushi vor der Tür. Um die Hand hat er ein Tuch gewickelt, das vom Blut getränkt ist. Ein Hund, der sich von der Kette losgerissen hat, hat ihm ein Stück vom linken Daumen einfach abgebissen. Lushi ist aufgebracht, weil der Hausherr sich nicht um die Sicherheit seines Hundes gekümmert hat. Er schwört Rache – blutige Rache. Seine tiefe Bisswunde interessiert ihn nicht. Ich rufe Schwester Michaela und wir machen die Notversorgung. Es fehlt ein Stück vom Daumen und der Knochen guckt raus. Lush will nicht ins Krankenhaus, lieber sterben. Und er will sich den Herrn des Hundes vorknöpfen. Nach dem Kanun zahlt der schwer und wieder droht Lushi, weil er auch meint, der Nachbar habe den Hund auf ihn gehetzt. Wieder taucht das Gespenst der Blutrache auf und irgendwie reicht es mir. Wir schaffen es, den Gebissenen zu beruhigen und Leci, unser Mitarbeiter, begleitet ihn ins Krankenhaus. Innerhalb von einer Stunde werde ich jedoch fünfmal angerufen, weil unser Patient abhauen will. Leider kommt noch ein weiterer schwerer Notfall und Lushi muss einige Stunden warten, bis der Operationssaal frei wird. Unser Mitarbeiter ruft aus einer Kneipe an, in der er mit dem Alkoholkranken Lushi zum Raki trinken gegangen ist – zum Überbrücken. Und Leci meint, dass sein Patient ganz gut drauf ist. Nach einer Stunde kommt ein Anruf, dass Lushi verschwunden ist. Seitdem hocken wir auf Kohlen. Ich bin sofort ins Livade, um mit den Leuten zu reden, damit Lushi nicht eine Dummheit macht und Rache nimmt. Sie versprechen, aufzupassen und sich zu melden und die Angelegenheit mit dem Hund mit den Ältesten und Lushi gut zu regeln. Und ich hoffe, dass der Verletzte doch noch bei uns vorbeikommt. Er blutet stark und braucht dringend einen Verbandswechsel.
So wird es hier langsam Sommer und der blaue Lavendel in unserem Garten blüht bereits. Wenn der Wind wie eine Welle über die Lavendelfelder weht und sich am Horizont mit dem Himmel verbindet, ist es fast nostalgisch und in diesen Momenten weiss ich, dass ich dieses Land mit seinen Menschen mit all seiner Schroffheit und seiner Wildheit liebe. Und ich bin dankbar, dass wir hier sein dürfen.
Euch allen, die Ihr uns so treu unterstützt, so dass wir hier sein können, danke ich von Herzen. Und wir alle vom Klösterle wünschen Euch einen guten, von Gott gesegneten Sommer.
Mit herzlichem Gruss
Sr. Christina
Unwetter
Liebe Freundinnen und Freunde,
grüss Gott. Wir getrauen uns, Euch diese Fotos zuzumuten. Gestern Nacht (14.05.2021) hat es im Osten von Shkoder und in einigen Dörfern dort einen halben Meter gehagelt. Der Schaden ist gross; die Gemüseernte, die Trauben- und Obsternte für dieses Jahr ist zerstört. Die Menschen sind traurig und wir natürlich auch. Es tut fast weh zu sehen, wie es in unserem Garten nach wie vor blüht, wir die ersten Erdbeeren ernten können und drüben , wo auch einige Mitarbeiterinnen her sind, haben sie nichts mehr. Wir konnten wenigstens einigen neue Setzlinge zusagen, aber da steigen über Nacht die Preise immens.
Nun, wir sind dankbar, dass alle leben,dass die Hagelkörner klein waren und nicht noch Personen und Häuser beschädigt wurden. Dürfen wir Euch um Euer Gebet bitten. DANKE.
Gott segne Euch und wir grüssen Euch herzlich
Sr. Christina und Sr. Michaela



Lebendig werden
Liebe Schwestern und Brüder
Es ist der 1. Mai und ich grüsse Euch ganz herzlich aus dem Klösterle in Albanien. Es wird auch Zeit, dass ich mich wieder melde. Schnell verflog der April. Wenn man ihm Launenhaftigkeit zuschreibt, so war das diesmal das passende Attribut. Aber es steht ihm wohl zu, diesem Monat, mit vielschichtigen Launen der Natur uns Menschen vielleicht auch zum Nachdenken zu bringen.
Die letzten Tage hatten wir warmes Frühlingswetter; die ersten Rosen blühen, die Maiglöckchen aus meiner Eltern Garten haben sich hier gut eingelebt und blühen vor meiner Klosterzelle. Apfelbaum, Kirsche und Birne sind mit der Blüte durch. Im Livade, unserem Wohngebiet, sind nach dem Hochwasser kleine Wunder geschehen. Es war unsere grosse Sorge, wie der Müll in den Kanälen bewältigt wird, wie es weitergehen wird nach dem Schlamm und Dreck und Müll.
Zuerst fingen in einem Teil des Gebietes die Männer an, freiwillig ihren Kanal zu säubern. Schwere Dornen, Gestrüpp und der angeschwemmte und auch abgeladene Müll mussten weggeräumt werden. Sie arbeiteten hart und es war das erste Mal, dass Männer hier Müll wegräumen und nicht die Frauen. Und dass sie das mit den Händen tun und keinen Bagger möchten. Wir besorgten die Macheten, Rechen und Schaufeln und sie werkelten. Auf diese Aktion reagierten glatt die öffentlichen Fernsehsender und verlangten nach Interviews. Und unsere einfachen Männer konnten gut artikulieren, dass sie sich jetzt unter die Naturschützer zählen. Und sie sind stolz auf ihre Aufgabe und dürfen dies auch sein.
Dann war da ein anderer Kanal, der zur völligen Müllhalde verkommen war. Die Familien dort leben hinter grossen Mauern und waren immer sehr verschlossen. Der Gestank nach dem Hochwasser hat aber vor den Mauern nicht Halt gemacht. Ich sah eigentlich keine Möglichkeit, hier jemanden zum Säubern des Kanals zu motivieren. Eines Tages fuhr ich vorbei und sah eine junge Frau und Mutter von zwei kleinen Kids, wie sie ihren Hausmüll auch dazu schüttete.
Ich zögerte kurz und spürte, wie ich mich ärgern möchte darüber. Als ich das Auto bremste, bremste ich mich auch ab und stieg ruhig aus. Ich fragte die junge Frau, warum sie ihren Müll hier rein-schmeisst. Ich wusste, dass sie eine Mülltonne hat und unser Müllmann auch hierher kommt zum Müll einsammeln. Sie antwortete schnippig, dass dies ja alle tun und zeigte mir relativ deutlich, dass dies mich gar nichts angehe. Ich wurde kämpferisch und auch neugierig und fragte sie, ob sie sich vorstellen könnte, dass hier statt einer Müllhalde ein schöner Garten wäre mit Blumen und Pflanzen und ob ihr das gefallen würde. Sie guckte verdutzt und sagte: «Ja, klar würde mir das gefallen». Ich sagte zu ihr: «Ok, pass auf: übermorgen (ich weiss noch genau, dass es Mittwoch war, als ich sie traf) um 10 Uhr bin ich hier. Du bringst ein paar andere mit und ihr fangt an, den Garten zu bauen. Also, bis übermorgen!» Sie guckte mich an und lächelte etwas merkwürdig, wenn nicht mitleidig mit mir. Ich glaube, sie meinte ich wäre übergeschnappt. Ich gebe zu, an diesem Freitag dann habe ich überlegt, ob ich überhaupt rausfahren soll. Aber ich bin los. Und dann traute ich meinen Augen nicht: Da waren 6 junge Frauen, die warteten und bereits mit dem Wegräumen der Dornen begonnen hatten. Sie kamen auf mich zu und übertrafen sich, mir zu sagen, wie sie einen Garten machen möchten, wie sie etwas Schönes tun möchten usw. Nun, am zweiten Tag waren 14 Frauen versammelt. Und sie schafften und planten und waren kreativ, wie ich es nie erträumt hätte. Und alle arbeiteten und sie waren glücklich. Es ist ein richtiger kleiner Park entlang des Weges entstanden. Wir konnten Pflanzen kaufen und einen Wasserschlauch zum Bewässern. Dann hatten die Frauen noch den Wunsch, eine Muttergottes in den Park zu stellen. Die bekommt jetzt noch eine Grotte. In feierlicher Prozession wurde sie installiert. Nun habe ich den Frauen versprochen, öfters zu kommen.
Sie möchten viel wissen: über den Glauben, über Gott, über Kindererziehung und wie man die Umwelt schützt. Es ist neues Leben, neue Hoffnung, ein Miteinander, das allen dort wie ein Wunder erscheint. Garten Eden sage ich dazu. Der Geist weht, wo und wie er will.
Ja und lebendig war es für mich die letzten zwei Wochen auch, bedingt noch durch etwas anderes: Ich wurde zum Unterricht für die Klassen 6 bis 9 zum Thema «Pubertät» in eine grosse Schule gebeten. Ich gebe zu, ich hatte Respekt vor dieser Aufgabe, nicht zuletzt wegen des Zeitfaktors. Aber Schwester Michaela redete mir zu und verwies mich mit Recht auf Priorität. Es ist hier so, dass dieses Thema noch so viel wie ein völliges Tabu ist. Und die Jugendlichen sind mit all den Fragen und den Problemen ihrer Entwicklung allein gelassen. Die Lehrer können nicht aus ihrer Tradition und das Thema wird übergangen oder höchstens mit Geboten oder Verboten gespickt behandelt. Das Wort Sexualität wird sowieso ausgespart. Nun, wir gingen es an. Und es waren tolle Tage mit den Kids. Aber es hat in mir auch viel Nachdenklichkeit hinterlassen und wie und ob man das Thema weiter und breiter angehen kann. Ein paar Dinge daraus beschäftigen mich besonders: mindestens 70 % der ca. 140 Schüler die ich hatte, waren und sind in Pornoseiten im Internet – natürlich ohne Wissen der Eltern oder Lehrer, mindestens ein Viertel hat bereits gekifft. Dies sind vor allem die Jungs, die hier ja viel mehr Freiheiten haben als die Mädchen. Ich stellte fest: Ahnungslosigkeit und gesellschaftliches Tabu, dann eben der heimliche Konsum von all dem, was aus dem Westen zu konsumieren ist. Diese «Mischung» ist meines Erachtens einfach eine Katastrophe.
Ich beobachtete die Kids, wie sie erleichtert waren, dass jemand zuhört, dass dies alles mal zum Thema wird, dass sie nicht einfach verurteilt werden oder man sie als schlimme Sünder bezeichnet. Ein Dreizehnjähriger streckte den Finger und fragte leise: Du, ist es wahr, dass ich keine Kinder mehr zeugen kann, weil ich masturbiert habe? Ich merkte, dass etliche dieselbe bange Frage in sich tragen. Wie diese Jungs aufatmeten, als ich ihnen sagte, dass dies ganz und gar nicht stimme. Sie applaudierten und einige rissen wirklich wie befreit die Hände hoch, einer pfiff. Dann die Mädchen: ich fragte sie, wer denn lieber ein Junge sein möchte. Von 30 Mädchen flogen bei 29 die Hände sofort hoch. Als ich fragte: «Ja, warum möchtet ihr ein Junge sein?» kamen zwei Antworten:
Hauptgrund: «Dann sind wir stärker». Der zweite Grund: «Dann sind wir auch freier.» Wir haben darüber noch lange geredet. Schläge und beherrscht werden von den Brüdern scheinen ihnen «normal» zu sein und doch regt sich langsam aber sicher der Aufstand. Ein Mädchen sagte mir, dass sie auch leben wollen wie alle Mädchen in Europa. Ich bin immer noch betroffen und nachdenklich und habe das Gefühl, dass wir hier vor einem Vulkan stehen, der zu brodeln beginnt und der Ent-lastung braucht. Und ich habe auch das Gefühl, dass man mit diesen tollen Jugendlichen die Welt verändern kann. Sie haben Kraft, sie haben Disziplin, sie sind einzig orientierungslos. Und sie brauchen uns Erwachsene als Freunde, nicht als Moralapostel und Angstmacher. Und ich gebe zu, ich dachte an meine Gemeinschaft, die ja den Namen «Weggemeinschaft» trägt. Nun, ich durfte ein kleines Stückchen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben teilhaben. Der geplante Unterricht ist abgeschlossen, es bleiben aber Anfragen an mich vonseiten der Schule.
Weitere Anfragen gehen an uns: immer mehr Kranke kommen, immer mehr Krebskranke, die Palliativversorgung brauchen, liegen daheim. Und in unserer Ambulanz ist die Überbelastung sozusagen Normalzustand geworden. Covid hat die Situation verschärft. Derzeit gehen jedoch offiziell die Zahl der Erkrankten zurück. Wir haben keinen Lockdown, an die Maskenpflicht hält sich kaum jemand. Überall treffen sich die Menschen und wenn man Covid hat, so überlebt man oder man stirbt. Es wurde hier mit Impfungen begonnen, von überall her ist verschiedener Impfstoff gekommen. Wir hoffen und beten, dass sich die Situation weiter stabilisiert. Manchmal taucht da in mir die Situation in Indien auf und Sr. Michaela und ich fragen uns, wie wir hier eine solche Welle schaffen würden. Dann wissen wir, dass wir das einzig und allein dem Schöpfer überlassen müssen und dürfen. Und das ist auch gut so.
Nun gehen wir dem Fest des Heiligen Geistes entgegen und wir bitten, dass der Geist Gottes, dieser Geist des Lebens, Euch und uns besuchen und beleben möge und dass die Kreativität des Schöpfer-geistes uns den Mut und den Elan gebe, um an die Ränder zu gehen zu jenen, die auf uns warten. DANKE für all Eure Hilfe, Eure Gebete und Eure Solidarität.
Mit besten Segensgrüssen
Sr. Christina mit Sr. Michaela

Frohe Ostern
Für ein paar Sekunden die Augen schliessen und sich von Freude bestrahlen lassen.
Für ein paar Sekunden den Krisenhaufen wegräumen und dem heilenden Schöpferatem nachspüren.
Für ein paar Sekunden in den eigenen Garten der Seele gehen und den Auferstandenen erblicken.
Frohe Ostern Euch allen
Sr. Christina, Sr. Michaela , Lukas, Abri und Toni

Rückblick auf den Kreuzweg
Liebe Schwestern und Brüder,
viele von Euch sind den Kreuzweg mitgegangen und wir möchten, stellvertretend für viele gute Rückmeldungen einfach diese Reflexion von Christine weitergeben. DANKE für Eure Teilnahme und eine gesegnete Heilige Woche
Sr. Christina
Hier nun die Worte von Christine Müller
Liebe Schwester Christina,
Du, ich wollte abschließend zu unseren Kreuzwegstationen noch sagen, dass ich schon lange nicht mehr so einen intensiven Input im Glauben bekommen habe. Es waren wirklich ganz tolle Fastenexerzitien. Wir haben alle voneinander gelernt. Menschen ohne Grenzen waren gemeinsam auf Safari unterwegs und sind Freunde geworden. Wie eine Safari war es schon auch anstrengend. Aber als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, da taten ihnen sicher auch manchmal die Füße weh...
Herzliche Grüße, eine gute, gesegnete Karwoche und dann Frohe Ostern!
Christine
Alltagswunder in schweren Zeiten
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat,
Die Fastenzeit hat begonnen, die Zeit der Vorbereitung auf das Leben – durch alle Tode hindurch. Draussen in unserem Garten blühen die Osterglocken und der Frühling ist eingekehrt. Viele Tage waren wir im Bangen um eine weitere grosse Hochwasser-katastrophe. Bange und Hoffen – jeden Tag, jede Nacht – so lange drei Wochen lang. Das Wasser ist da und war da, aber wir können nur dankbar sagen: Gott sei DANK – wir wurden vor dem Schlimmsten bewahrt. Ja, das Wasser steht noch und stinkt teilweise in den Gärten, Wiesen und Feldern, aber das Frühlingswetter lässt die Hoffnung wachsen. Und wir machen Pläne für die Aufräumphase. Viele Brunnen müssen desinfiziert werden, viel Müll muss weggeräumt werden, Kanäle brauchen grundlegend Säuberung.
Ich denke auch noch an all die Glückwünsche zum Bundesverdienstkreuz und möchte Euch allen DANKE sagen dafür. Wir sind überwältigt von so viel wohlwollender Resonanz. Und da möchte ich nun von Menschen erzählen, die jeden Tag so ein Verdienstkreuz ver-dient hätten. Sie tragen ihr Schicksal, ihre Armut und ich frage mich manchmal, wie dies noch möglich ist. Manchmal denke ich dabei an Wunder des menschlichen Überlebens, an zarte Berührung der Seelen, von denen ich keine Ahnung habe, ich jedoch sehr behutsam und achtsam damit umgehen möchte.
Da ist unser Lushi, so ziemlich jeden Tag total betrunken; ertrunken im Elend nach dem Verlassen der Berge, nachdem er nun während Corona auch als Tagelöhner keine Arbeit mehr findet. Regelmässig, mindestens jeden zweiten Tag steht er nun vor unserem Tor. Seit kurzer Zeit kann er das Schloss öffnen und steht somit unmittelbar an der Haustüre. Neulich, noch bei strömendem Regen, liess er sich grölend, fluchend, schreiend vor dem Tor nieder. Er war entschlossen, nicht zu gehen, bevor wir ihm nicht Tierfutter bezahlen. Er weiss jedoch ganz genau, dass wir ihm kein Geld in die Hand geben. Immer wieder erstaunt uns, wie er uns aber letztlich respektiert. Ich ging raus und wollte ihn schlichtweg nach Hause schicken. Er liess sich dann endgültig nieder und sass in der Wasserpfütze. Lushi kriegt man nicht so einfach los. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Ich liess ihn erstmal sitzen und grölen. Dann kam ich auf die Idee, ihm einen Teller mit Essen zu bringen, denn es war Mittag. Vorsichtshalber reichte ich es ihm durch den Zaun. Er stand sofort auf, gab mir den Löffel in die Hand und bat mich, ihm das Essen zu geben. Er hatte Heisshunger. Bei jedem Löffel strahlte er mehr und als der Teller leer war, fragte Lushi, ob er diesen Teller mitnehmen dürfe, denn er sei überzeugt, dass da nun jeden Tag das Essen für ihn drin sei. Nach Handkuss – trotz Corona – ging er dann des Weges. Seitdem bekommt er hier seine Mahlzeit. Und nun hatte Sr. Michaela heute die Idee, dass wir ihn zum Säubern des Kanals anstellen und dafür bezahlen. Er ist zudem hoch intelligent und wir hoffen, dass er sich stabilisiert.
Und da ist Tonia. Sie hat drei Kinder; die Älteste ist 13 Jahre. Ihr Mann ist arbeitslos und krank. Tonia schmeisst den Laden ohne Klage. Jetzt beim Hochwasser ist das Wasser in der letzten Sturm-Nacht ins Haus gedrungen. Wir trafen sie, als sie ihre Kinder zu den Gross-eltern ins Trockene brachte. Tonia geht jeden Tag in die Fabrik. Dort verdient sie zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Jeden Tag schob sie ihr Fahrrad 80 cm durchs Hoch-wasser. Ich traf sie dann patschnass zur Fabrik radelnd. Es ist klar, dass wir ihr sofort hohe Fischerstiefel gebracht haben. Ihre Kinder sind immer gewaschen, sie gehen regelmässig zur Schule, sie kommen immer in die Gruppenstunden. Tonia klagt nie, nie. Wir konnten der Familie wenigstens noch rechtzeitig Ziegelsteine zum Hochstellen der Möbel bringen, bevor das Wasser alles einnahm. Tonia ist eine von vielen albanischen Frauen, die jeden Tag wie ein Bollwerk gegen die wachsende Resignation stehen, die jeden Tag ihre Überlebens-strategie und ihren unbändigen Lebenswillen der um sich greifenden Passivität ihrer Männer trotzen. Ich habe vor, Tonia in unsere vor einigen Monaten gegründete Frauengruppe einzuladen. Diese Gruppe ist wie ein aufkeimender Blumensame und ich bin gespannt, was daraus noch wird. Leise und erstaunt lernen sie die Welt kennen, in der man Meinung haben darf, seine Gedanken austauschen kann. Sie sind noch sehr scheu, wenn sie einfach einen Kaffee trinken dürfen, da sein können und mal eine Stunde nichts tun müssen – gar nichts – nicht mal beten. Neulich habe ich mit ihnen einfach eine Atemübung gemacht und eine Frau fing zu weinen an und sie sagte: «Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gespürt, dass ich atme». Tonia muss dies auch tun dürfen: einfach Dasein und atmen – inmitten der Armut, inmitten der harten Fabrikbedingungen, die kein Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit zulässt.
Und da ist noch Abraham. Viele fragen immer wieder, wie es ihm denn geht. Nun, er wurde jetzt am 19. Februar 14 Jahre alt. Und wir sind glatt stolz auf ihn, wie er so sein Leben im Rollstuhl lebt. Was mich stark bewegt, ist vor einigen Tagen geschehen: In der Schule hat Abri gerade in Geschichte den 2. Weltkrieg. Er interessiert sich total für Geschichte und möchte immer wieder Dokumentationen über einzelne Epochen per Video gucken. Nun, er wollte dann auch Dokus über den 2. Weltkrieg angucken. Und er wählte auch einen Bericht über Euthanasie an Behinderten während der Nazizeit aus. Ich schluckte, aber es war mir klar, dass ich ihm das auch erlaube. Und er bat – wie meistens – dass ich diese Doku mit ihm gucke. Wir beide waren sehr still und ich beobachtete ihn natürlich auch. Irgendwann stoppte Abraham das Video kurz und stellte dann lakonisch fest: «Mom, der hätte mich auch getötet». Beklommen nickte ich. Nach dem Film fragte er nur noch belanglose Sachen und meinte, er möchte jetzt nicht weiter drüber reden. Ich verstand. Zwei Tage später musste er für den Geschichtsunterricht einen Bericht über die Hitlerzeit vorbereiten. Er sagte mir, ich müsse ihn gar nicht abfragen, er wisse genau, was er sage. Als er an diesem Tag von der Schule kam, sagte er mir folgendes: «Mom, ich habe in Geschichte das erzählt, wie der Hitler uns getötet hat».
Und in dieser Auseinandersetzung, da hat der Abri zwei gute Freunde und die drei Jungs machen nun auch beim Projekt »Kreuzweg» mit. Sie «drehten» die Station: «Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen».
Da bin ich noch bei einer Ankündigung:
Das Projekt »Kreuzweg». Ab dem 14. März wird für 14 Tage jeden Tag eine Kreuzweg-station dargestellt und über unsere Homepage ins Internet gestellt. Die Kreuzwegstationen werden von verschiedenen Gruppen und auch Einzelpersonen gestaltet – alles nonverbal. Da sind Schulklassen dabei, die drei Freunde eben, Jugendgruppen, ältere Menschen, ein Jesuitenkolleg usw. Immer am Abend um 20 Uhr bieten wir dann zur jeweiligen Station per Zoom eine Austauschmöglichkeit an. Das Ganze ist jetzt schon in der Zeit der Vorbereitung sehr spannend. Eine Teilnehmerin hat gesagt: «Es sind jetzt schon für mich Fasten-exerzitien». Ich freue mich, dass viele unterschiedliche Gruppen länderübergreifend beteiligt sind und die Sprache keine Rolle spielt. Wer sich in diesen Tagen einklinken möchte, ist herzlich eingeladen. Wir geben kurz vorher noch die weiteren notwendigen Informationen dafür bekannt.
Nun schliesse ich mit der Vorstellung eines kleinen Besuchers unseres Klosters: fast jeden Abend kommt «ein Vogerl» geflogen. Eine Amsel hat ihr Nachtlager im Seiteneingang bei unserer Kapelle gewählt. Sie kommt bei Einbruch der Dunkelheit, lässt sich auf dem roten Kasten vom Feuerwehrschlauch nieder und bei Tagesanbruch ist sie lautlos wieder ver-schwunden. Das Vögele gehört schon richtig zur Klosterfamilie. Wir schliessen den warmen Nachtvorhang schon immer früher, damit wir es nicht im Anflug vertreiben. Und Sr. Michaela oder ich gucken dann später ganz vorsichtig, ob das Vögele da ist. Dies ist schon fast ein Ritual geworden und es ist, als bringe es uns die Leichtigkeit des Lebens und vielleicht hat es ja auch eines Tages ein «Zetterl im Schnabel». Wer weiss!
Nun wünschen wir Euch allen eine gesegnete Fastenzeit. Kardinal Schönborn hat am Aschermittwoch von der Fastenzeit als der Zeit gesprochen, in der wir die tiefe Freude am Leben, an Gott und aneinander entdecken dürfen. Und dies wünsche ich inmitten einer nicht so leichten Zeit.
Mit herzlichem Segensgruss
Sr. Christina

11.02.2021
Neue Informationen zum Hochwasser
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat
Wir möchten Euch kurz eine Krisenmeldung geben, verbunden mit der Bitte um Euer Gebet.
Seit drei Wochen ist viel Ackerbau- und Weidegebiet um uns rum unter Wasser. Nun ist seit heute Nacht unser Wohngebiet so betroffen, dass das Wasser in die Häuser eindringt und wir über den Weg mit dem Auto auch nicht mehr ins Livade kommen. Aber über einen Umweg ist es heute noch möglich gewesen, ins Gebiet zu gelangen. Viele Häuser sind nun vom Wasser umgeben, drei Familien evakuiert. Wir haben ein Zimmer für eine Familie mit einem an Krebs erkrankten Vater gerichtet. Trinkwasser gibt es schon länger nicht mehr; die Sickergruben mit Fäkalwasser laufen mit dem Brunnenwasser zusammen, überall schwimmt der Müll. Die Weidetiere haben nichts mehr zu Fressen. Die Menschen wirken resigniert. In dieser Situation denkt niemand mehr an Maskenpflicht und Corona. Eben rief Irena an und sagte, dass die ersten Schlangen versuchen, in ihr Haus zu gelangen. Die fliehen vor dem Ertrinken nun in die noch trockenen Häuser.
Wir teilen wieder mal Ziegelsteine zum Hochstellen der Möbel aus, Gummistiefel, Fischeranzüge, Decken, Viehfutter. Und wir versuchen, die Menschen etwas menschlich zu stützen, wenigstens da zu sein.
Klar sind wir auch in Spannung, was die kommende Nacht bringen wird. Jeder Regentropfen ist nun einer zu viel. Und wieder einmal sagen wir: jetzt können wir nur noch beten.
Und wir danken für Euere Solidarität einmal mehr.
Mit herzlichen Segensgrüssen
Sr. Christina mit Sr. Michaela

Eine Schlange versucht ins Haus einzudringen:

Bundesverdienstkreuz
Liebe Schwestern und Brüder und Freunde in der Heimat,
Mitten im Krisenmodus, zwischen Covid und drohendem Hochwasser auch in unserem Wohngebiet, wird mir – und uns - am Freitag, 29. Januar hier im Klösterle das Bundesverdientskreuz verliehen.
Wer möchte, kann virtuell daran teilnehmen. Ab 11.30 könnt Ihr unter dem genannten Link zuschalten. Wir können keine ganz genaue Zeitangabe machen, da es abhängig ist vom Eintreffen des Deutschen und des Schweizer Botschafters.
Gerne treffen wir Euch auf diesem virtuellen Wege.
Herzlichen Segensgruss
Sr. Christina
Und hier der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6fzWeYOTZow&feature=youtu.be
Adventskalender 2021
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat,
der Advent ist sehr nah und wir möchten Euch auch in diesem Jahr wieder ein bisschen an unserem adventlichen Leben hier in Albanien teilhaben lassen.
Wenn die Kirche den synodalen Prozess begonnen hat, so reihen wir uns da mit unseren bescheidenen Adventsfenstern mit ein und sind in diesen Tagen gerne mit Euch unterwegs.
Und wir hoffen, dass Ihr alle die schweren Tage der Coronaausbrüche gut bewältigen dürft. Wir hören vom Westen besorgniserregende Nachrichten und beten für Euch.
Und so könnt Ihr am Mittwoch, den 1.Dezember das erste Fenster öffnen, während wir am Sonntag bereits die erste Kerze anzünden dürfen. Dies werden wir hier an unserem Kanalgarten im Livade mit den armen Familien gemeinsam tun.
Mit herzlichem Segensgruss aus Dobrac
Sr. Christina, Sr. Michaela, Abraham, Antonio, Felicitas und Lukas

Adventskalender 2020
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat,
Der Advent klopft fast unmerklich an. Draussen picken ein paar Kohlmeisen an unsere in Orange leuchtenden Kakis rum. Und Covid scheint an jeder Ecke zu lauern, um uns zu vereinnahmen. Und wir möchten Euch in dieser kommenden Zeit mit unserem Adventkalender an unserem Leben hier teilnehmen lassen. Ihr könnt ab dem 1.Dezember den Kalender hier auf dieser Webseite abrufen oder über die Webseite:
www.spirituelle-weggemeinschaft.ch
Derweil wünschen wir Euch einen guten ersten Adventssonntag mit dem ersten Licht in einer vielleicht ungewohnten dunkleren Zeit. Wir wünschen Euch die Gewissheit, dass das Licht leuchtet und wir wünschen uns die Kreativität, selbst ein wenig mehr Licht der Welt zu verwirklichen in diesen eher chaotischen Wochen, wo sich viele nach der «staaden Zeit» sehnen. Wir freuen uns, diese Zeit mit Euch teilen zu dürfen.
Mit herzlichem Segensgruss
Sr. Christina

Begegnung
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde in der Heimat,
grüss Gott aus dem Klösterle. Wir hoffen, Ihr seid wohlauf und dürft Euch auch ein wenig an den Herbstfarben freuen.
Ich bin wahrscheinlich den letzten Morgen in diesem Jahr draussen an der Muttergottesgrotte gehockt, um die Laudes zu beten und ein wenig zu meditieren. Ein paar Weinbergschnecken kreuzen meine Gedanken, buchstäblich. Sie eilen nicht und ich denke, ob sie manchmal über meine Hektik ihr Haus schütteln vor Lachen. Die Luft ist schwül heute Morgen und in der Nacht hat die Erde wieder gezittert. Seit etlichen Tagen gibt es Erdbeben bis zu 4,6 auf der Richter-Skala in der Gegend, wo letztes Jahr das grosse Erdbeben war. Ich segne die Erde und das Wetter an diesem Morgen. Es ist Sonntag. Ich lasse die letzten zwei Wochen nochmal vorbeifliegen. Über mir ächzt der angerissene Ast unserer Trauerweide. Auch hier ist es nach sehr heissen Wochen kühler geworden und der Regen ist gekommen. Gott sei Dank. Wir hatten die letzten vierzehn Tage immer wieder starke Unwetter, aber alles ging noch relativ glimpflich ab. Unsere Garage hat es in einer Nacht überschwemmt, die Küche im Kinderzentrum auch. Es hat den Bauern Früchte von den Bäumen geschlagen und teilweise auch die Obsternten vernichtet. Wir sind dankbar, dass die Unwetter keine Leben gekostet haben. Mit Corona ist die Lage hier noch chaotischer geworden. Unsere Ambulanz ist auch «überschwemmt». Patienten, die dringend ins Krankenhaus gehören, kommen hierher. Sie haben Panik vor dem Krankenhaus wegen einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Und dann hält sich hier sehr zäh die Fake News, dass Kranke mit Corona in den Krankenhäusern eine Todesspritze bekommen. Das Vertrauen in das medizinische System war eh schon angegriffen; jetzt ist es sozusagen unter null. Da kommt ein Vater mit seinem Jungen. Er hat eine schwere Milzvergrösserung und ganz hohe Leukozytenzahl und hohes Fieber. Er hat mit seinem Sohn das Krankenhaus, genau wegen dieser Angst, auf eigene Verantwortung verlassen und meinte nun, wir machen den Jungen hier mit irgendeinem Wundermittel gesund. Solche Situationen häufen sich. Und die Ambulanz ist eine Art Sozialzentrum geworden. Viele, viele schicksalshafte Lebensgeschichten werden da neben den körperlichen Gebrechen ausgepackt. Da ist eine Frau, die sich verbrannt hat und jeden Tag daheim Gewalt erlebt. Sie ist leider kein Einzelfall. Die Frauen hier können nicht in ein Zentrum gehen und Hilfe holen. Es in der eigenen Familie publik zu machen oder zu den Eltern zurückzukehren, ist fast unmöglich, da die Tradition des Kanun hier sehr strikt ist: Die Frau gehört ab der Hochzeit der Sippe des Mannes. Immer wieder gelingt es jedoch auch, dass eine Frau ihre Opferrolle erkennt und aus dieser Rolle sozusagen aussteigt. Wir haben ja dafür teilweise auch wochenlang Zeit, denn Brandwunden heilen ja nicht an einem Tag. Und auch Männer «packen» aus in der Ambulanz. Vor zwei Tagen war da Xhupi, ein Mann wie ein Schrank so körperlich stabil. Seine Verbrennung war nicht so schlimm, aber seine Haut am Fuss war trocken und rissig. Ich cremte dann den Fuss noch ein und da fing er an zu weinen. Und er sagte: «Schwester, ich habe schmutzige Füsse. Du cremst sie einfach.» Er weinte weiter und erzählte: «Meine Tochter hatte ein gutes Geschäft mit dem Schwiegersohn. Alles war in Ordnung. Dann kam Corona. Sie verloren alles durch den Lockdown. Sie sind noch nach Deutschland abgehauen. Irgendwo sind sie mit den zwei Enkelkindern in einem Lager. Ich bin allein. Meine Frau ist tot. Ich möchte nicht mehr leben. Und Du cremst mir nun die Füsse. Was mache ich denn jetzt?» Wir redeten lange. Es ging ihm besser, als er gestern wiederkam.
Ein Vater bringt seine verbrannte kleine Tochter. Wir wissen, dass dieser Mann sein Geld nicht auf legale Weise verdient. Nach dem Verbinden macht er seinen fetten Geldbeutel auf und da strotzen die 5000 Lek-Scheine. Er möchte bezahlen. Ich sage ruhig: «Nein, du kannst dieses Geld ein paar armen Bettlern auf der Strasse geben. Wir nehmen kein Geld, bete für uns!» Da ist er durcheinander. Ich sage ihm: «Mit Geld kann man nicht alles machen, weisst Du? Unser Dienst ist hier kostenlos, aber wir bitten um Dein Gebet. Hast Du das Vaterunser vergessen? Als kleiner Junge hast Du es gebetet!» Ich gucke ihn an; er nickt. Und ich sage: «Du wirst dich erinnern, das weiss ich. Bete dann für uns, für Dich und Deine Tochter.» Wieder nickt er und steckt seine Geldscheine in die Tasche. Ich gebe ihm den Segen. Er guckt mich völlig erstaunt an.
Unsere Patienten sind auch erfinderisch in Bezug auf Distanzmassnahmen nicht einhalten. Es fällt den meisten sehr schwer, ein wenig Distanz zu halten und keine Dankküsse zu verteilen. Nun, die Gesichtsmaske lässt das ja nicht so zu. Da kommen dann inzwischen einige der Patientinnen auf die Idee, mir einfach die Schulter zu küssen. Und so manches mal ist dann der Lippenstiftkuss am Habitärmel oder halt als «Abzeichen» auf der Schulterpartie der Kleidung.
Ich möchte noch von unseren Kids im Kinderzentrum erzählen. Wir haben festgestellt, dass die Kids in der Coronakrise oft die stillen Leidenden sind. Die Erwachsenen finden leichter ihren Weg. Sie können drüber reden, drüber diskutieren, über Massnahmen auch schimpfen usw. Und die Kinder sind verstummt; ihre Ängste können sie nicht artikulieren. Das Phantom, das Corona heisst, schwirrt ihnen dann in der Phantasie herum, aber bekommt keine konkreten Formen. Die Aggressivität nimmt zu. Eine Erzieherin erzählte mir, dass ihr ein paar Kinder rigoros die Maske vom Gesicht reissen und diese dann zerstören. Wir haben ein Programm entwickelt, wie wir mit den Kids in dieser Zeit umgehen können, dass sie das Corona-Trauma einigermassen gut überstehen. Zum Programm gehört auch ein Puppen-theater. Leider sind auch die Coronazahlen hier steigend und ab Donnerstag ist Masken-pflicht überall, draussen und drinnen. Für Nicht-Einhalten gibt es Strafen. Diese Geldbussen sollen mit den Stromrechnungen verschickt werden.
Unser Müllabfuhrmann Franzi hatte mit seiner gesamten Familie Corona. Es ging ihnen schlecht und es war schwierig, ihnen die Einsicht zu vermitteln, dass sie nun in Quarantäne gehen müssen. Die Oma der Familie war schwer krank. Sie wurde aber daheim versorgt. Für eine Infusion anhängen, musste die Familie sehr lange eine Krankenschwester suchen, die das dann für viel Geld machte. An Coronakranken, die daheim sind, wird sehr viel Geld verdient. Denn die Gefahr, angesteckt zu werden, erhöht hier den Preis für das Anstecken einer Infusion oder das Geben einer Spritze um ein Vielfaches. Wir brachten dann der Familie Lebensmittel, Hygieneartikel und alles, was sie brauchten. Und Franz meinte dann, so gut habe er im Leben noch nie gegessen.
Nun, dann ist da eben Sonntag. Um 13.30 sagt mir Sr. Michaela, dass drüben, 200 Meter weit von uns, am Verkehrskreisel bei den 5 Helden eben ein Polizeichef aus der angrenzen-den Region im Auto angeschossen wurde. Sein Vater wurde auch schwer verletzt. Die Attentäter sind mit dem Motorradl gekommen und verschwunden. Der Polizist schwebt in Lebensgefahr. Am Abend sagt uns ein Freund, dass immer noch die Scherben vom Auto-fenster auf der Strasse liegen. Ich bin wieder mal betroffen. Diese Strasse ist die Hauptachse von Nord-Süd in Albanien und die Unglücksstelle ist nicht gesäubert nach einem halben Tag! Ich rufe diesbezüglich noch einen Polizisten an, aber der lacht mich fast aus. Nach kurzer Rücksprache mit Sr. Michaela entscheide ich, an den Kreisel zu fahren und die Scherben aufzukehren. Der Gedanke, dass da Menschen angeschossen wurden, jetzt um das Leben kämpfen und jeder über die Scherben fährt, das ist für mich völlig inakzeptabel. So nehme ich Besen und Schrubber, Kehrschaufel und einen Eimer und fahre los. Ida kommt mit, um ein wenig aufzupassen, dass ich nicht von einem Fahrer zusammengeschrubbt werde, denn dort ist viel Verkehr. Und es ist kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Am Strassenrand sind ein paar Flüchtlinge, die die Balkanroute für die Flucht benutzen und machen Pause. Ich grüsse sie, parke das Auto mit Warnblinklicht und steige aus. Viele feine Glasscherben sind auf der Strasse. Ich denke daran, dass ich 20 Minuten vor dem Attentat dort vorbeifuhr, um Abrahams Freund zu holen. Viele Autos kommen, aber sieverlangsamen. Ich beginne, die Scherben zusammen zu kehren und in den Eimer zu leeren. Ein junger Autofahrer stoppt kurz und ruft aus dem Fenster: «DANKE Moter, Gott segne Dich!» Und dann dauert es keine Minute, da stehen vor mir zwei der Flüchtlinge. Einer der Jungs umarmt mich, sagt: «Oh Mama!» und nimmt mir den Besen aus der Hand und kehrt zusammen. Der andere kippt die Scherben in den Eimer. Dann umringen mich alle Vier und wollen eine kurze Umarmung und jeder kehrt ein wenig. Ich stehe einfach nur da, meine Gesichtsmaske ist mir längst aus dem Gesicht gerutscht. Die Autos fahren vorbei und stoppen zeitweise kurz. Ich habe in diesen paar kurzen Minuten kein Zeitgefühl, erlebe nur unglaubliche Intensität der menschlichen Begegnung zwischen bis dahin sich völlig fremden Menschen. Dann sind die Glassplitter alle im Eimer. Ich gebe dem ersten Flüchtling die Hand und lege einfach meine Hand auf seine Stirn, um leise zu segnen. Da kommt der nächste Junge, zeigt zum Himmel und beugt seinen Kopf und so machen es alle. Die muslimischen Brüder von der Strasse möchten den Segen – Glaubensgrenzen fallen hier. Und sie verstehen weder Englisch noch albanisch noch deutsch. Sie kommen alle aus Afrika; dies konnten sie vermitteln. Aber auch die Sprachgrenzen sind hier nicht relevant, diese Sprache mitten auf der Strasse in all dem ist eine andere. Ein paar von ihnen haben Tränen in den Augen und sagen nochmal «Mama». Dann gehen sie weiter, den Weg Richtung See. Wir wissen inzwischen, dass Schlepper für die Route über den See sehr viel Geld verlangen.
Diese Begegnung werde ich nie vergessen; sie hat sich jetzt schon eingegraben. Und aus den Glassplittern werde ich einen Mosaikengel machen. Das, was dort an Unheil am Mittag an diesem Sonntag geschehen ist, kann man nicht rückgängig machen. Aber auch das, was dann am Abend geschah, bleibt in einer ganz kleinen Geschichte wie als Gegenstück präsent, auch wenn es noch so unscheinbar für die grosse Welt ist.
Und auch Ihr, die Ihr uns mit so viel Kreativität in diesen Krisenzeiten helft und unterstützt, tragt viel dazu bei, dass Gutes geschehen darf und kann und wir da sein können für die Menschen hier. Dafür sagen wir DANKE und Vergelt`s Gott.
Mit den besten Segenswünschen
Sr. Christina und Sr. Michaela

Sr. Michaela räumt die abgebrochenen Äste in unserem Klostergarten weg.
Virtueller Münsterlauf 2020 nach Albanien
Ziel Dobrac, Klösterle Mutter der Barmherzigkeit, weit überschritten!
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
Eine Woche blieb uns Zeit, 26. September bis 4. Oktober und so viele sind mitgelaufen. Egal, ob die km über die Laufapp aufgezeichnet, oder ob sie uns anders mitgeteilt wurden – es war ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis, ein sich solidarisch zeigen mit denen am Rande der Gesellschaft in dem europäischen Land Albanien, dem Armenhaus Europas.
Dort engagiert sich Schwester Christina aus Donauwörth und ihre Mitschwester Michaela aus der Schweiz seit Jahren mit unglaublichem Einsatz für hunderte arme Familien, für das Kinder- und Jugendhaus Arche Noah, in einer medizinischen Ambulanz und für vieles mehr.
Sie freuen sich sehr über Euer dabei sein und über die Spenden von insgesamt 1000,00 €, die im Rahmen des Münsterlaufes dafür eingegangen sind und die, die vielleicht noch eingehen werden!
1280 km wären das Ziel gewesen, 2.176,4 km sind zusammengekommen!
43 Läufer*innen haben über die Laufapp registriert und 108 Läufer*innen haben uns analog ihre km gemeldet, also insgesamt 151 Läufer*innen.
Radl-km waren erst nicht erlaubt. Doch dann kam eine Meldung, die uns überzeugt hat, die km doch mit aufzunehmen:
Liebes Münsterlaufteam,
ja ein virtueller Münsterlauf, eine super Idee, nach Albanien zu laufen – aber nichts mehr für meine Füße…So hab ich ein Münsterradln gemacht, in Gedanken, im Gebet unterwegs zum Klösterle. Auch wenn diese km keinen Eintrag in die Statistik bekommen, Gott wird es in Segen verwandeln. In diesen 9 Tagen bin ich 313,7 km geradelt, bergauf, bergab….denke dabei sein ist alles! War auf vielen Wegen unterwegs. Bin gespannt wie viele km ihr gelaufen seid.
Seid lieb gegrüßt, eure Radlerin Edeltraud!
Ja, danke Edeltraud, danke an alle Läufer*innen, danke an alle, die diesen besonderen Münsterlauf ermöglicht haben, besonders an Armin Furthmüller, der uns mit seiner Idee und Unterstützung die Entscheidung ganz leicht gemacht hat, den Münsterlauf 2020 stattfinden zu lassen, anders, aber immerhin!




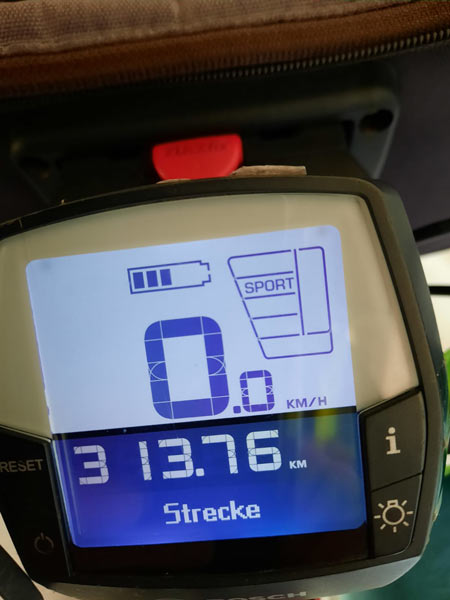








Feuer und Wasser
Liebe Freunde in der Heimat,
Grüss Gott. Und wer Urlaub hat, dem wünschen wir gute ruhige Tage in diesen Ausnahme-zeiten. Wir wären eigentlich jetzt auch in der Schweiz und dann in Deutschland, aber wir bekamen mit unseren zwei albanischen Jungs keine Einreisegenehmigung. CORONA hat zugeschlagen. Schwester Michaela ist vor drei Tagen los nach Rheinau, um unseren Bus in den Service zu bringen und für die Ambulanz Nachschub zu holen. Wir hoffen, dass sie nun morgen ohne Probleme hier wieder einreisen kann. CORONA hat bislang die Hilfstransporte nicht zustande kommen lassen. Nun, aber CORONA und die damit verbundenen Mass-nahmen hindert uns nicht, das Wesentliche zu tun. CORONA hindert mich nicht, das Leben in vielen Facetten zu begreifen und mich nicht eingrenzen zu lassen von dem, was täglich über dieses Virus berichtet wird. Ich kann darüber hinausdenken und fühlen und Dinge wahrnehmen, die auch noch da sind. Und so sind wir hier im heissen August.
Gerade warten wir auf ein Baby, das in Tirana mit Kaiserschnitt zur Welt kommen soll oder muss. Die Mama wurde in Shkoder nicht angenommen. Dank Irena, unserer unermüdlichen Mitarbeiterin, hat sich der Arzt in Tirana bereit erklärt, an diesem Tag heute vom Strand zu kommen und den Kaiserschnitt zu machen. Dies ist hier nicht selbstverständlich.
Ja, das Wasser, der Strand, das Meer ist in diesem Monat wirklich Lebenselixier für Viele. Wir waren einige Male mit den Kids im «Gardenland». Es ist ein Ferienhotel mit grossem und sauberem Schwimmareal. Und Abri rutscht vom Rolli direkt ins Wasser. Toni quietscht vor Vergnügen und fliegt förmlich im Wasser. Gestern haben wir allerdings alle Atemprobleme bekommen. Ringsum brannte an den Hügeln der Wald und die Rauchwolke war zwischen-durch beissend und legte sich auf die Atmung. Es war für mich irgendwie paradox: «Ich schwamm im Wasser rum und schnappte wegen dem Waldbrand nach Luft». Die Asche legte sich dann wie ein Film auf das Wasser. Und ich war plötzlich auf eigenartige Weise mit den zwei Elementen konfrontiert. Ja, die Wälder brennen überall und auch im Kloster mussten wir die Tage vorher öfters die Fenster schliessen, da der Brandgeruch sehr stark war.
Bei Temperaturen von 38 bis 40 Grad denken wir dann auch an die vielen Kranken, die in ihren Betten hier wirklich nur noch leiden. Die Häuser sind nicht isoliert – es dampft, die Fliegen machen sich an die teilweise offenen Geschwüre der Leidenden ran. Heute Nacht nun sah ich dann um 23.00 Uhr hinten am See starkes Wetterleuchten. Eine Stunde später zuckten unzählige wunderbare Blitze fast ununterbrochen vom Himmel und ich schaute diesem Schauspiel eine halbe Stunde gebannt zu. Ja, die Blitze hielten mich in ihrem Bann und ich dachte unwillkürlich an die Feuersäule der Israeliten, die durch das Rote Meer schritten und Gott in der Feuersäule sahen. Und auf der anderen Seite auf den Hügeln da brannte es zu dieser Zeit noch lichterloh und die Flammen züngelten meterhoch. Und ich stand irgendwie dazwischen und spürte wie mich dieses Land in seiner Schroffheit und Ursprünglichkeit und auch Schutzlosigkeit nur auf den EINEN verweist. Und als ich da stand, da kam mir die Saga des Prometheus, wie er den Menschen das Feuer zurückgebracht hat und Zeus ihn dafür an den Felsen nagelte. Und ich fragte mich, ob ich nun hier und sofort den Mut aufbringe, meinen Schöpfer in aller Ernsthaftigkeit um das Feuer des Geistes Gottes bitte, dass mich das Leben geben lässt, wenn es darauf ankommt. Innerlich ging ich irgendwie schlotternd vor einem grossen Geheimnis in die Knie. Und der Regen kam, wenigstens kurz. Dieses Nass schien mir kostbar wie schon lange nicht mehr. Feuer und Wasser! Und ich dachte daran, wie es wohl wäre, wenn die Menschen die Energie eines Blitzes speichern könnten. Wieviel Strom hätten wir! Versuchung, mir eine Allmacht anzueignen, die mir nicht zusteht!! Wie gut, dass sich die Urgewalt des Blitzes nicht gefangen nehmen lässt – egal für welchen Zweck. Unkontrollierbar und gut so!
Bislang hatte ich bei so einem Unwetter hier immer Schwester Michaela zur Seite. Heute Nacht bin ich allein mit den Kids und der jungen Ida, mit der Sicherung des Hauses, mit den zwei Hunden im Hinterhof. Die Kids schlafen; die zwei Hunde sind ruhig, einzig das Gewitter und der Sturm sprechen in mein Schweigen, zu mir – ich bin die Hörende, die Suchende. Ich spüre meine menschliche totale Kleinheit vor diesen Naturgewalten und weiss einmal mehr, dass mich diese Gewitternacht auf die Demut verweist; die Tugend, die mir wohl oft genug abhandenkommt. Und in diesen Nachtstunden ist drüben auf den Feuerhügeln durch den Regen der Brand gelöscht.
Die Kühle draussen lässt mich um 4.00 Uhr die Fenster aufreissen. Der Morgen bricht langsam durch. Und so ein ganz anderer Morgen ist für Kini angebrochen; der Morgen der Ewigkeit. Nicht Covid, sondern der Knochenkrebs mit Lungenmetastasen hat seinen vor Kraft strotzenden Körper innerhalb von 9 Monaten aufgezehrt. Ich habe schon von ihm erzählt. Nun, wir konnten den Familienvater noch in der Isolationsphase wegen Corona von Italien repatriieren. Wir trieben Sauerstoffflaschen auf, damit seine massive Atemnot etwas erleichtert werden konnte; wir konnten ihm Schmerzmittel und Antihustenmittel geben. Und wir begleiteten Kini und seine Familie in dieser Zeit intensiv. Er hinterlässt, neben seiner Frau, zwei Töchter und einen Sohn mit 13 Jahren. Sebastian ist der Schulfreund von Abraham. Auch Abri und Leo haben sich in diesen Wochen als treue und zuverlässige Freunde von Sebastian gezeigt. Sie haben mitgelitten und sich mit Sterben, Tod und Trauer konfrontiert und sind nicht vor dem Leid weggerannt. Die Kids hier lernen schnell, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und sie müssen dies auch lernen in diesem Land, das hart aber auch real und «geerdet» ist. Die verlogenen Schnörkeleien fehlen hier im Norden noch – Gott sei Dank. Die «Spass-Partys» sind mit Corona hier nicht aus oder verboten, sondern die gab es gar nicht.
Zurück zu Kini: Drei Tage vor seinem Tod wollte er unter allen Umständen noch zum Heiligen Antonius nach Lac. Es ist der Pilgerort, zu dem jeder Albaner geht – egal welchen Glaubens oder Nicht-Glaubens. Kini war zu dieser Zeit schon nicht mehr fähig, ein paar Meter selbst zu gehen. Aber er war entschlossen, den Heiligen zu besuchen, auch wenn er dort sterben würde. So ermutigte ich seinen Schwager, ihn dorthin zu bringen – mit einer transportierbaren Sauerstoffflasche. Mir war irgendwie klar, dass dieser Mann diese Wallfahrt für seinen letzten Weg braucht. Und er schaffte es. Dann, drei Tage später schafft er seinen letzten Weg. Ich werde gegen Abend gerufen. Vorsichtshalber packe ich noch ein paar Handtücher ein, weil der Bruder sagt, er habe die letzten Stunden Blut gehustet. Weihwasser nehme ich mit, das Sterbekreuz auch. Es ist Hektik und Hilflosigkeit im Haus, als ich komme. Aber die Verwandten beruhigen sich schnell, als ich zu Kini trete. Es ist mir klar, dass er nun in der akuten Sterbephase ist. Er möchte sitzen; wir helfen ihm und auf einer Seite bin ich, auf der anderen einer seiner Brüder. Leise rede ich zu ihm und er hört alles. Ich sage ihm, dass er weitergehen darf, dass er diesen Weg gut macht, dass er nicht mehr kämpfen muss. Wir beten, ich sage die Allerheiligenlitanei, die Angehörigen antworten: «Bitte(t) für ihn». Seine Frau und seine Kids und nahen Verwandten sind nun um das Bett, berühren Kini und lassen ihn wissen, dass sie da sind. Sie verabschieden sich schmerzlich, aber lassen ihn los. Sebastian küsst seinen Papa das letzte Mal. Dann möchte der Sterbende besser aufsitzen. Ja, er möchte aufrecht an der Pforte des Paradieses stehen – so scheint es mir. Der Bruder steigt ins Bett und Kini lehnt sich in den Schoss des Bruders. Und so geht er fast leicht – so leicht, dass alle erstmal nur schweigen – Kini und sein Sterben haben in diesen Momenten das Weinen und Klagen der Frauen gestoppt. «Hier ist heiliger Ort, hier ist Respekt vor dem Tod». Das war die Botschaft. Und Corona?
Das Virus hat bei diesem Geschehen einfach keinen Platz. Im Sterben keine Nähe geben, im Sterben dem Sterbenden nicht den Todesschweiss wegwischen, nicht den letzten Kuss geben, das ist hier nicht möglich, das wäre für die Leute aus den Bergen der Tod jeglicher menschlichen Kultur. Es gibt darüber nicht mal einen Gedanken, dies überhaupt aus irgendwelchem Grund zur Disposition zu stellen. Dies ist mir in diesen Minuten mehr als bewusst; so bewusst, dass auch ich gar nicht darüber nachdenke. Ich bin ein Teil dieses Geschehens. Corona ist völlig wie entmachtet – vom Tod als Geschehen des menschlichen Lebens selbst. Ewigkeit steht wie mit Blut geschrieben im Raum. Es wäre für diese Menschen hier der psychische, soziale und spirituelle Tod, wenn sie sich hier im Sterben nicht eng versammeln könnten. Sie geben dafür ihr physisches Leben, wenn es dann nötig wäre. Und ich spüre, dass dies weit ab ist von so schnell gesagter «Verantwortungslosigkeit oder Leichtsinn». Dies alles ist jenseits von Corona und jenseits der Massnahmen, jenseits von was weiss ich…Es ist das ursprüngliche Leben der Menschen hier. Und ich bin wieder mal ein Teil des Lebens dieser Menschen hier geworden. Und als ich gehe, bitten sie mich, dass ich ihnen und dem Toten nochmal das Kreuzzeichen gebe. Es ist schon Abend und dunkelt ein. Kini hat ausgelitten. Und seine Familie braucht uns. Die nächsten Tage werden schwer für sie. Die Zeremonien der Beerdigung nach der Tradition des Kanuns steht bevor. Die Trauer hat ihren Platz und Corona wird auch hier verbannt.
Ich möchte zufügen, dass wir uns hier keineswegs gegen Corona-Sicherheitsmassnahmen aussprechen. So habe ich in den letzten Wochen, nachdem ich wieder gesund war, drei Workshops zu Corona und den möglichen Schutz davor abgehalten. Wir sind darauf bedacht, die Menschen zu schulen, dass ein Mindestmass an Eigenverantwortung im Schutz gegen Corona erlernt und ermöglicht wird. Dabei ist die Spannweite auch gross. Ich tue mich, ehrlich gesagt schwer, den Roma in der Siedlung zu vermitteln, dass sie sich sehr oft die Hände waschen müssen, diese aber kein fliessendes Wasser zur Verfügung haben. Ich kann nicht Händewaschen mit Seife fordern, wenn Seife unerschwinglich teuer ist für eine Familie. So haben wir diese Monate «gefühlt» tonnenweise Seife gekauft und verteilt. Ich kann nicht sagen, dass die Mitglieder einer Familie nicht aus einer Flasche trinken dürfen, wenn sie nicht für jeden ein Glas haben usw. So gehen wir hier die ganz kleinen Schritte: wir gucken, wen wir mit welcher Situation vor uns haben und raten dann, suchen dann nach der sichersten Lösung, die ein Mindestmass an Sicherheit geben kann. Alles andere, jede geforderte Massnahme, die sowieso nicht eingehalten werden kann, bringt das Gegenteil: die völlige Ignoranz. Und wieder mal gilt es - wenigstens für uns: individuell oder für kleine Gruppen das raus zu fühlen, zu hören, was so oft gesagt wird: «Die Menschen da abholen, wo sie gerade stehen.»
Ich hoffe, ich habe Euch nun mit diesen Eindrücken, die ich geteilt habe, nicht bedrückt. Das ist mir fern. Ich danke für alle Mitsorge in diesen Wochen, für jedes Gebet, für jedes Paket und für jegliche materielle Hilfe, damit wir helfen können. Gottes Segen erbitten wir Euch gerne.
Mit herzlichem Gruss und dem Wunsch für eine gute restliche Sommerzeit
Eure Sr. Christina
Weiterlesen
Leises Wehen
Liebe Freunde daheim
Grüss Gott vor Pfingsten. Es ist noch Früh, wenn ich heute schreibe. Unser Pfingstfeuer-Strauch, wie wir ihn nennen, blüht wie in Feuerflammen. Schon ganz früh hat mich Schwester Michaela nach draussen gerufen, um mir unsere neuen kleinen Gäste zu zeigen. Drei Kätzchen hat uns vermutlich jemand über Nacht in den Garten gebracht. Bereits ab 7.00 Uhr stehen in diesen Coronawochen die Armen draussen, um etwas zu erbetteln. Immer wieder staune ich über den starken Überlebenswillen der Kreaturen. Und ich denke tief im Herzen: «Das Leben ist unsägliches Geschenk und schön». Und es drängt mich, Euch eine wunderliche Geschichte zu erzählen. Vielleicht ist es eine Pfingstgeschichte.
Ich wurde vor einigen Tagen dringend gebeten, eine Familie mit grossen Problemen in den Bergen zu besuchen. Mit einer Sondergenehmigung wegen Corona fahren wir sehr früh los Richtung Vermosh. Wie immer, wenn ich in die Berge gehe, klopft mir das Herz einfach höher. Ich sehe den roten Mohn, der Arnika blüht auch. Nach zwei Stunden machen wir eine kleine Pause am Fluss. Klar ist die Luft. Ich bekomme noch einige Informationen über die Familie und ihre Schwierigkeiten. Der älteste Junge hat die Diagnose Autismus, ist wohl tagelang im Bergwald unterwegs und der Vater wird mir als Tyrann gezeichnet, ohne jegliches Interesse für den Jungen. Die Mutter scheint völlig überlastet, da sie noch einen kleineren Sohn hat und noch zwei pflegebedürftige Familienmitglieder versorgen muss, für Haus und Hof zuständig ist und einfach nicht mehr weiter weiss mit Arlando, dem autistischen Kind.
Ich bin ein wenig in Spannung, als wir uns der Einöde nähern. Der Chaffeur, die etwas riskanten Bergtouren gewöhnt, muss durch den Fluss, da ihm die Brücke nicht sicher genug scheint. Die Strömung reisst den Landrover ein wenig herum, aber der Fahrer beherrscht seinen Job. Dann müssen wir noch einen Holperweg Richtung Haus und Hof nehmen. Das Lattentor ist mit einem Pferdeseil fest verknotet und wir brauchen ein paar Minuten, um uns den Durchgang zu schaffen. Zwei kläffende Hunde heissen uns nicht gerade willkommen. Wir warten im Auto, bis Angehörige der Sippe kommen. Der Grossvater hat die Hunde schnell beruhigt und die junge Mutter begrüsst uns mit der bekannten albanischen Gastfreund-schaft. Schnell erzählt sie ihre Sorge und Not um ihren Zwölfjährigen. Sie hat die Idee vom Ausland und dass Arlando dort mit einer guten Medizin schnell gesund und normal wird wie alle anderen Kids auch. Und da streift der Junge auch schon an uns vorbei. Er lässt sich auf keine Begrüssung ein, der mitgebrachte Ball interessiert ihn auch nicht. Die Mutter meint, ihr Junge müsste mich jetzt zur Begrüssung küssen und mir brav die Hand geben. Ich versuche ihr zu sagen, dass sie Arlando einfach Zeit lassen soll und er kommen kann, wann er will oder auch nicht. Es ist keine Beleidigung für mich. Sie ist erleichtert. Dann erzählt sie mir die Geschichte von Arlando. Mit 3 Jahren begann die Symptomatik, seine Isolation, seine Hypermotorik, sein Weglaufen, der erlernte Sprachschatz war wie verflogen, er verweigerte Kontakt, lautierte irgendetwas. Und sie sagt, sie habe den Verdacht, dass ein böser Blick ihren Jungen getroffen hat. Wie oft schon habe ich solche Geschichten gehört. Ich erkläre, versuche Verstehen und Verständnis der Mutter für die andere Entwicklung ihres ersten Sohnes zu eröffnen. Und ich weiss, dass sie, die Mutter für das alles verantwortlich gemacht wird. Dann kommt der Vater ins Spiel. Er begrüsst mich eher abweisend und schroff. Ich entschuldige mich, dass ich ohne seine Erlaubnis ins Haus bin. Er war bei unserem Kommen auf der Weide bei den Kühen. Der Vater dreht sich um und geht raus in den Hof. Dort ist auch sein Sohn und rennt rum. Die Mutter sagt, dass sie für ihren Sohn keine Zeit hat und der Vater sich nicht interessiert. Ich gehe raus zum Vater und frage, ob ich mich ein wenig zu ihm auf die Holzbank setzen darf. Er ist erstaunt und rutscht mir einen Platz frei. Hager ist er, um nicht zu sagen, dürr. Arlando taucht auf und gibt schnalzende Laute von sich. Der Vater schaut mich an. Und ich frage: «Verstehst Du ihn?» Er zuckt mit den Achseln. Ich sage, dass ich glaube, dass sein Sohn eine eigene Sprache hat. Er antwortet kurz und bitter: «Ich habe dafür keine Zeit, ich habe Kühe, die ich versorgen muss. Ich habe für ihn keine Zeit. Die Kühe brauchen Gras und Heu». Ich gucke ihn an und zeige ihm Verständnis und frage ihn: «Sag, bist Du der Vater Deiner Kühe oder der Vater Deines Sohnes?» Diese Frage löst mit einem Schlag die Mauer zwischen uns. Er schluckt und sagt, dass noch nie jemand so etwas gefragt hat. Dann wird sein Gesicht offen und er erzählt, wie er mit seinem Sohn von Arzt zu Arzt ging, wie er alles Ersparte genommen hat, um mit Arlando nach Italien zur Behandlung zu gehen, wie er bei Institutionen um Hilfe bat. Man hat ihm sogar eine Hirnoperation empfohlen. Als er erzählt, spüre ich, dass es da eine tiefe Beziehung zwischen Vater und Sohn gibt. Die ist nicht sichtbar, versteckt, verschämt, aber geprägt von einem Vater, der schmerzlich auf seinen kleinen Sohn blickt und ihm nicht helfen kann. Es ist die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn, der keine Erwartung erfüllt. Aber zwischen diesem hageren Vater und seinem Sohn, da schwingt etwas, das ich nicht mit Worten beschreiben kann und auch gar nicht beschreiben möchte. Arlando tänzelt um seinen Vater, als dieser seine Geschichte mit mir teilt. Ich erlebe, dass er die Stimme des Vaters sucht. Ich frage dann den Vater, ob er denn wisse, wo der Junge hingeht, wenn er in den Wald und in die Berge verschwindet. Und da nickt er und sagt, dass dies aber bislang niemand wisse. Ich schaue ihm ruhig in die Augen. Ein wenig unsicher beginnt er zu erzählen: Vor einigen Wochen ist er Arlando heimlich nachgegangen. Sein Sohn kletterte nach langem Durchstreifen des Waldes zielgerichtet und gewandt in eine Felsspalte. Dort kauerte er und wartete. Dann näherten sich zwei Vögel und setzten sich rechts und links von ihm. Die Vögel begannen zu zwitschern und Arlando übernahm die Zwitscherlaute wie seine Sprache und blieb so mit den zwei Vögelchen eine geraume Zeit. Dann flogen die Vögel weg und Arlando machte sich auf den Weg zurück. Dem Vater liefen die Tränen über das Gesicht und er schaute mich gespannt an.
Auch mir kullerte eine Träne runter und ich sagte leise zum Vater, dass er einen wunder-baren Sohn hat und er ein wunderbarer Vater ist. Und der Mann neigte seinen Kopf und küsste meine Hand. Und ich dachte an den Geist des Lebens und der sich schenkenden Liebe. Und ich sah ein Kind mit wundersamer Sprachengabe.
Wir wünschen Euch das Wehen und Wirken des lebendigen heiligen Geistes Gottes. Frohe Pfingsten
Eure Sr. Christina mit Sr. Michaela
Nebenschauplätze – oder doch zentral?
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat, liebe Freunde überall
Es ist Sonntag nach Ostern, der Sonntag der Barmherzigkeit, wie er heissen darf. Und ich denke, wie viele Facetten die Barmherzigkeit Gottes wohl hat in diesen Tagen? Und ich denke, wie viel Kreativität dieser Gott uns gibt, damit wir, ja wir, in dieser Krise das Erbarmen erfahren und weitergeben. Und ich frage mich, ob es mir das Herz und den Magen und das Gehirn umdreht und mobil macht, wenn ich an die Betroffenen der Krise denke und sie vor allem vor mir habe? Aber zuerst: wir hoffen, dass es Euch «drüben» einigermassen gut geht, dass Ihr nicht erkrankt seid und mit Euren Lieben irgendwie den Kontakt halten könnt. Wir hoffen, dass Ihr die «Massnahmen» unbeschadet überstehen dürft und ohne totalen «Koller» durchgehen könnt. Dafür bitten wir auch. Und wir beten, dass Gott der Allmächtige uns beherrschen darf, dass ER SEINE Gnade ausgiessen darf über uns und nicht das Virus alles beherrscht, alle Gedanken, alle Handlungen und Regungen. Wir hoffen und beten, dass der Geist Gottes, der Geist des Lebens in unseren jetzt sehr geschlossenen Lebensräumen den Atem des Lebens und der Heiligkeit und der Achtung vor jeglichem Leben neu ausgiessen darf. Und so wird das Virus und die Folgen nicht das letzte Wort haben.
Und wir hier? Ich möchte ein wenig aus der letzten Woche berichten. Wir hatten ja wirklich alle am Beginn vom Februar eine schwere Grippe. Viele Mitarbeiterinnen waren, ebenso wie Abraham, zusätzlich von einer schweren, doppelseitigen Lungenentzündung betroffen. Diese Phase ist vorbei. Aber Shkoder hat nun etliche registrierte Corona-Patienten. Unser Wohngebiet in Kiras und Dobrac ist sozusagen ein «Coronanest» geworden. Wir halten Hygieneregeln ein; die hielten wir aber sowieso schon vorher, da wir immer auch infektiöse Patienten in der Ambulanz haben. Uns beschäftigen hier mehr die «Nebenwirkungen» der Schutzmassnahmen und der Isolation, der Schliessung aller Institutionen und Geschäfte, der Fabriken usw.
Seit Freitagnachmittag herrscht nun bis Montag früh absolute Ausgangssperre. Aber seit gestern gibt es Ausnahmen: gestern durfte ich als Pensionistin (ab 60 Jahre) bis 11 Uhr mittags raus zum Luft schnappen. Heute dürfen nun Mütter mit Kids bis zu 10 Jahren auch so lange raus. So ein bisschen wie im Zoo. Schwester Michaela kam gestern an und meinte etwas ironisch: «Heute bist Du dran, aber alleine. Morgen kann ich ja dann mit dem Toni raus auf die Promenade.» Wir haben zum Luftschnappen unseren Garten und geniessen jedes Blümle, das neu blüht.
Sr. Michaela und ich haben eine Sondergenehmigung für Sozial- und Krankendienste. Das sieht dann so aus: Wir befinden uns auf den Nebenschauplätzen: Jeden Morgen (ausser jetzt eben am Wochenende) fährt Sr. Michaela los mit ihrer Sondergenehmigung. Sie passiert Polizei- und Militärkontrollen inzwischen relativ unbehelligt. Sie kauft Unmengen von noch vorhandenen Lebensmitteln ein. Diese werden dann bei uns zu Carepaketen verpackt und dann wieder von Sr. Michaela an jene verteilt, die nicht aus den Häusern können. Die anderen Armen, die jetzt noch ärmer sind, stehen dann am Vormittag vor unserem Tor. Manche haben eine Gesichtsmaske, die meisten nicht. Wer Hunger hat, interessiert sich nicht für Schutz und kann vor allem keine Maske kaufen. Er braucht was zum Essen für die Kids. Zum Schutz davor, dass nicht etliche Familienmitglieder einzeln kommen, um mehr Pakete zu erhalten, müssen wir inzwischen die Identitätskarten verlangen. Oft kommt Sr. Michaela heim und erzählt, dass die Familien schon nichts mehr zum Essen hatten, bis von uns Nachschub kam. Und sie erzählen auch, dass die eingeschlossenen Kids jetzt viel mehr Hunger haben. Und auch unsere Kindergartenkinder haben keine Mittagsmahlzeit mehr, die sie im Kindergarten bekommen.
Wie viele inzwischen ihre Arbeit in Fabriken, als Tagelöhner, in Kleinstgeschäften etc. verloren haben, das wissen wir nicht. Es sind bestimmt viele. Neben Lebensmitteln gehört zum Carepaket inzwischen auch Seife zum Händewaschen. Wir hoffen, dass das Wasser einigermassen reicht, aber nicht alle haben Zugang.
Dann ist da ein neues Phänomen, mit dem wir in der Krise wohl auch rechnen müssen: Panikreaktionen der Patienten. Es wurde eine junge, relativ schwer verbrannte Frau angemeldet. Sie kam mit ihrem Mann und musste einige Augenblicke im Korridor warten. Die junge Frau war «schwer» ausgerüstet: professioneller Mundschutz, Handschuhe und nochmal ein Tuch rum. Dann marschierte Ndua, ein älterer Patient, aus der Ambulanz und die junge Frau rastete aus. Sie weigerte sich, in die Ambulanz zu gehen und sich dort das todbringende Virus zu holen, wie sie sagte. Sie ging voll auf Angriff über und ich blieb mal in sicherem Abstand stehen. Sr. Michaela versuchte, sie zu beruhigen. Aber da wurde es ihrem Mann zu viel und er wollte sie mit Gewalt in die Ambulanz zerren. Er war nahe daran, sie einfach zu verhauen. Das konnte verhindert werden. Wir erklärten dann, dass wir sie nicht zwingen werden zur Behandlung. Und wir gaben ihr das Verbandmaterial und die Salbe mit, in der Hoffnung, dass sie heilen darf. Solche Panikreaktionen müssen wir einfach im Blickfeld haben in solchen Zeiten. Das war unsere Passage zum Lernen. Und solange keine(r) bewaffnet vor uns steht, ist alles in Ordnung.
Dann ruft mich Sr. Rita an. Sie gehört einem ganz kleinen Konvent aus Italien an und ihre Schwestern und sie haben auch nichts mehr zum Essen, geschweige denn zum Verteilen an die Armen. Und sie bittet um einen Krankenbesuch bei einer noch recht jungen Frau, die mit Hirnblutung und Dekubitus unversorgt ist, da die Krankenschwester nicht mehr kommt aus Angst vor Corona. Diese Situationen haben wir jetzt sehr gehäuft. Ich packe alles ein, was mir so einfällt, um die Frau zu versorgen. Die 16-jährige Tochter der Patientin erwartet uns. Ricarda kümmert sich rührend um die Mama, aber sie hat Angst, weil sie eben jetzt alleine ist. Sose, die Mama, liegt sehr teilnahmslos im Bett. Damit sie ruhig bleibt, hat die Krankenschwester für die Zeit ihrer Abwesenheit einfach Haloperidol dagelassen. Das hat dann die Katastrophe bei Sose ausgelöst. Und sie ist seit drei Wochen wund gelegen. Das Trinken hat nicht mehr geklappt und so ist sie auch noch ausgetrocknet. Ich weiss, wenn wir es nicht schaffen, dass sie trinkt, wird sie an Austrocknung sterben, ihr Organsystem versagen. Ich arbeite mich zu Sose vor, indem ich mich zu ihr ins Bett setze und sie an mich ziehe. Sie ist nur noch Haut und Knochen. Meine Schutzmaske hängt irgendwo an einem Ohr und ich muss komisch ausgeschaut haben. Jedenfalls hat Sose dann irgendwann nach viel Zuspruch und Wangenstreichen reagiert und die Augen aufgemacht. Die Tochter fing zu weinen an, weil sie meinte, die Mama sei schon tot. Ich sagte Sose, dass jetzt noch nicht die Zeit zum Sterben sei, erzählte ihr, dass ihre Tochter sie noch brauche und dass schliesslich Ostern sei und sie noch nicht ins Grab könne jetzt. Als ich meine Bettpredigt beendet hatte, schlug sie nochmal die Augen auf und sagte glatt und trocken: «AMEN!» Nun fielen beinahe Sr. Rita und die Tochter in Ohnmacht. Dann gings weiter. Ich sagte: «Ein Glas Wasser bitte.» Ich sah einige Momente vorher, dass Sose wohl ihren Speichel geschluckt hatte, ein Zeichen, dass sie noch schlucken kann. Ricarda bekam Angst und sagte, ihre Mutter würde ersticken. Ich erklärte der Tochter ruhig, was ihr vorhatte und sie stimmte zu. Dann führte ich das Glas an den Mund und die Patienten schluckte und schluckte und trank das ganze Glas aus. Sie hatte Durst. Und dann lächelte sie. So erklärte ich dann Ricarda, wie sie ihre Mama versorgen könne und auch sie lächelte. Als ich dann Sr. Rita nach Hause fuhr, war da noch ein weiterer «Notfall», wie sie sagte. Vor ihrem Kloster kreuzte mit dem Radl ein älterer, magerer Mann auf. Sr. Rita erklärte mir, dass Gjon vor einigen Tagen aus dem Sanatorium entlassen wurde. Dort brauchen sie die Plätze wegen Corona und er mit seiner offenen Tuberkulose wurde mit einem Rezept heimgeschickt. Da stand er nun vor uns und hustete seine Tuberkel raus. Mundschutz, Handschuhe? Natürlich nichts dergleichen! Gjon hatte weder Geld seine Medikamente gegen die Tuberkulose zu kaufen noch eine Monete für Lebensmittel. Ich erklärte ihm, dass er unbedingt einen Mundschutz tragen müsse und zog ein paar unserer selbstgenähten aus der Tasche. Sr. Rita hat ihm dann noch Lebensmittel und etwas Früchte gekauft. Er hat offene Tuberkulose und wird bald das Blut husten, wenn er nicht Hilfe bekommt. Die Medikamente werden wir aus der Apotheke besorgen. Ich stellte mir dann vor, wie gerade die unsichtbaren Tuberkel von Gjon sich mit den Coronaviren treffen…und musste lachen. Und die gute Sr. Rita, meine Philosophenfreundin, fiel aus allen Wolken, als ich ihr erklärte, dass Tuberkelbazillen auch ansteckend sind und Gjon vermutlich an Tuberku-lose sterben wird, wenn er weiter so abmagert und sein feuchter Wohnwagen ein Tuberkel-nest bleiben wird. Ob Corona für diesen Mann eine Rolle spielt, wollte dann die Schwester wissen.
So häufen sich die Einzelfälle, die dem «Nebeneffekt» der Massnahmen zum Opfer fallen. Da ist noch Katharina, die voller Krebsmetastasen ist. Keiner kommt mehr, das Krankenhaus hat verweigert, ihr das massive Bauchwasser ab zu punktieren – wegen Coronagefahr. Keine Chance. Ich fahre zu ihr, bringe ein paar Erdbeeren, die sie noch essen kann. Sie spricht von ihrer Tochter, die in Italien festhängt. Letzte Gespräche – wir beide wissen es. Sie ist tief gläubig, ich bringe ihr die Hl. Kommunion. Und Schmerzmittel, denn die Tumorschmerzen sind unerträglich geworden. Aber sie erträgt alles. Sie wartet auf ihre Tochter. Und das Bauchwasser - nicht Corona - drückt ihr den Atem ab.
Und dann ist da die nächste Krebskranke ohne Schmerzmittel. Die anderen kommen nicht mehr. So ist unser Gebiet nun um einiges erweitert. Wir denken nicht an den nächsten Tag, was wir heute tun können, tun wir, das Morgen hat seine eigene Sorge, steht schon irgendwie so geschrieben.
Da sind dann auch noch unsere zwei Jungs. Der Antonio ist einfach ein Sonnyboy, aber auch er nimmt die Corona-Atmosphäre auf seine Weise wahr. So schlägt er vermehrt nach meiner Brille oder er macht einfach total Quatsch, wenn er essen soll. Abraham hatte einen Ausraster, weil einfach an Ostern ein Ritual ausgefallen war. Er hat nur noch geheult und geheult, dann konnte er gut artikulieren, was ihn so beschäftigt: «Nicht das ausgefallene erste Eis an Ostern, nicht dass es unbedingt das Schoki-Osterei nicht gab, sondern einfach, dass das Gewohnte nicht mehr ist. Und keine Freunde, keine richtige Schule, alle nur mit Corona… und immer wieder nur Corona. Uns ist, durch unsere Kids, jeden Tag sehr klar, wie sehr es den Familien jetzt an den «Nerv» gehen kann, wenn zu allen Sorgen um Arbeits-plätze, um die Ernährung, die Angst vor der Erkrankung auch noch rebellierende, streitende und provozierende Kids und Jugendliche daheim eingesperrt sind. Das ist die Heraus-forderung, der wir uns auch als Klosterschwestern stellen und mit allen Familien hautnah teilen. Auch wir haben Nerven und es ist uns bewusst, dass wir uns hier in dieser Corona- Sondersituation ganz bewusst in der Hand haben müssen. Und wenn da ein provokanter Schmetterer kommt von einem Jungen, der ganz genau weiss, dass er zur Risikogruppe gehört, dann ist es umso nötiger, das «dahinter» auch mitzuhören. Geduld brauchen wir alle ein paar Kilo mehr.
Und so können wir auch noch lachen, können miteinander die Zeit nutzen, eine Mühle spielen, in den Garten gehen und Sr. Michaela ist jeden Tag der Torwart und Abri knallt seine Bälle aus dem Rollstuhl, manchmal ein wenig aggressiver als sonst, ins Tor.
Ich möchte es nicht versäumen, Euch allen, die Ihr uns in diesen Zeiten mit Eurem Wohl-wollen, Eurer Solidarität, Euren Spenden und Euren Gebeten begleitet, unser ganz tiefes DANKE zu sagen. Vergelt`s Gott.
Möge der Allmächtige Euch gesund bleiben lassen und uns alle in diesen Zeiten vor allem bewahren, was uns schaden mag.
Mit herzlichem Segensgruss
Eure Sr. Christina mit allen hier im Klösterle

Ostergrüße aus dem Chaos, aus Armut und Hoffnungslosigkeit...
Liebe Schwestern und Brüder in der Heimat, liebe Freunde
Wenn wir nun diese Ostergrüsse an Euch übermitteln, kommen unsere Wünsche aus dem Chaos, aus Armut und Hoffnungslosigkeit der Bevölkerung. Corona und die Folgen der Krise schlagen knallhart ein:
In Schlangen betteln sie nun vor dem Tor – die vielfache Anzahl als in normalen Armutstagen. Viele haben bereits jetzt ihre Arbeit verloren, Renten wurden nicht ausgezahlt, die Roma können nicht mehr betteln, nicht mehr Alteisen sammeln, die ganz Elenden schaffen es in der einen Stunde die pro Tag für den Einkauf genehmigt ist, nicht mal mehr die Mülltonnen zu räumen. Das erledigen jetzt die wilden Hunde und Ratten umso mehr. Eltern, deren Kinder in Privatschulen sind, können die Schulgelder nicht mehr zahlen, «normal» Kranke werden in den Kliniken und Spitälern nicht mehr aufgenommen.
Eben haben wir miteinander geweint. Ein schwer verbrannter Patient erzählt, dass sein Schwiegersohn mit Krebs im Krankenhaus in Italien ist. Der Mann kann nicht mehr geheilt werden und wurde nun aus dem Krankenhaus geschickt. Wo er nun sterben soll, weiss er nicht. Ein verzweifelter Aufruf seines Schwagers zur Rückführung durch die Botschaft wurde gar nicht beantwortet. Die Frau ist mit ihm in Italien, die zwei Kids gehen mit Abri in dieselbe Schule und leben jetzt bei den Grosseltern. Sie wissen noch gar nicht, dass der Papa sterben wird. Und nun müssen die Schulgelder bezahlt werden – obwohl Unterricht per Internet ist. Ein Schicksal, ein anderes Opfer von Korona, wie so viele hier.
Schwester Michaela fährt noch mit einer bereits abgelaufenen Sondergenehmigung in die Stadt, besorgt das Nötige, teilt Lebensmittel aus, bringt Medikamente, mal einen Rosenkranz und was so helfen kann. Die Kranken schlagen sich noch hierher durch zu uns. Bislang hat die Polizei hier Gnade vor Recht ergehen lassen. Seit gestern sind hier im Wohngebiet nun 11 infizierte Frauen und Männer aus zwei Familien diagnostiziert. Und viele im Umfeld verstehen nur eines davon: «Die sind die Todesbringer, die sind schuld!» Das Chaos nimmt zu, die Panik wächst. Wir versuchen, Kontakt zu halten, zu deeskalieren wo es geht.
Und ich schreibe Euch nun diesen Osterbrief?
Ostern? Weit weg? Oder näher und realer als wir in unserem Gefühlsdurcheinander erfahren können?
Mit dem Osterbild, das Sebastian in der Isolation gezimmert hat, möchte ich unsere Wünsche an Euch, die Ihr drüben in der Krise seid, sagen:
Glauben wir, hoffen wir, lieben wir bis der Stein weggerollt wird
Glauben wir, hoffen wir, lieben wir, bis aus der Nacht das Licht aufbricht
Glauben wir, hoffen wir, lieben wir durch unsere selbst gezimmerten Sicherheiten hindurch zu dem der die heilsame Wahrheit ist
Glauben wir, hoffen wir, lieben wir durch alle Egoismen hindurch bis zur Hingabe des Lebens, wie ER es gegeben hat
Glauben, wir hoffen, wir lieben wir, bis wir in der Tiefe unseres Abgrundes und im Schatten des Todes IHN, den Auferstandenen neu wahrnehmen und als Erlöste demütig sagen:
« Rabbuni».
Wir wissen uns in diesen Tagen tief mit Euch verbunden.
Gesegnete Kartage, gesegnete Ostern
Sr. Christina mit Sr. Michaela









 So sind nun Miriam und Klodi mit in ein Dorf an der Grenze gefahren. Diesen Mann konnte ich nicht warten lassen. Gani wurde mit seinem Motorradl angefahren. Der Autofahrer hat ihn liegenlassen und ist abgehauen. Als sie ihn fanden, war er schwer verletzt. Er kam mit gebrochenem Jochbein und Schädelhirn-Trauma ins Krankenhaus nach Tirana. Bewusstlos war er da nicht mehr. Sie haben das gebrochene und verschobene Jochbein ohne Narkose sozusagen wieder an seinen Platz geschoben. Schmerzmittel hatte er dafür keine bekommen, nur die Anweisung, nicht zu schreien. Der Augapfel war wie verschoben, kauen kann er immer noch nicht richtig. Und Gani sagte Ärzten und Pflegern von Beginn an, dass es ihn am Rücken schmerzt und brennt und er sich sicher ist, dass er dort eine Wunde habe. Sie sagten, er wäre geröntgt, da sei gar nix! Er hatte schlimme Schmerzen am Rücken, aber keiner reagierte. Gewaschen wird man sowieso nicht. Nach vier Tagen wurde er in schlechtem Zustand entlassen. Dann sahen die Angehörigen die schwer nekrotisierte und infizierte Brandwunde, als sie in daheim anschauten. Der heisse Auspuff vom Motorrad hat sich durch die Kleidung in die Lende von Gani gebohrt. So fanden wir den Patienten schwer krank mit starken Schmerzen, ohne jeglichen Schlaf und irgendwie auch verzweifelt auf seinem Sofa liegend. Die Familie war hilflos. Bereits nach der ersten Versorgung ging es ihm besser. Gani konnte nicht glauben, dass er ernst genommen wird, dass er sagen darf, wie sehr es weh tut usw. Als wir gestern bei ihm waren, da begrüsste er uns an der Haustür und strahlte uns an. Es ist ihm nicht mehr schwindelig, er hat sein Gleichgewicht wieder gefunden. Und er kann sich an seinen vier jungen Lämmern freuen, die auf seiner Weide neben dem Haus rumhüpfen und auch für Gani den Frühling bringen. Wenn er uns dann immer mit Tränen in den Augen die Hände küsst, dann denke ich daran, wie dieser Mann erniedrigt wurde und wie er sein Trauma langsam überwinden wird. Und er wird wieder seine Lämmer und Schafe versorgen können.
So sind nun Miriam und Klodi mit in ein Dorf an der Grenze gefahren. Diesen Mann konnte ich nicht warten lassen. Gani wurde mit seinem Motorradl angefahren. Der Autofahrer hat ihn liegenlassen und ist abgehauen. Als sie ihn fanden, war er schwer verletzt. Er kam mit gebrochenem Jochbein und Schädelhirn-Trauma ins Krankenhaus nach Tirana. Bewusstlos war er da nicht mehr. Sie haben das gebrochene und verschobene Jochbein ohne Narkose sozusagen wieder an seinen Platz geschoben. Schmerzmittel hatte er dafür keine bekommen, nur die Anweisung, nicht zu schreien. Der Augapfel war wie verschoben, kauen kann er immer noch nicht richtig. Und Gani sagte Ärzten und Pflegern von Beginn an, dass es ihn am Rücken schmerzt und brennt und er sich sicher ist, dass er dort eine Wunde habe. Sie sagten, er wäre geröntgt, da sei gar nix! Er hatte schlimme Schmerzen am Rücken, aber keiner reagierte. Gewaschen wird man sowieso nicht. Nach vier Tagen wurde er in schlechtem Zustand entlassen. Dann sahen die Angehörigen die schwer nekrotisierte und infizierte Brandwunde, als sie in daheim anschauten. Der heisse Auspuff vom Motorrad hat sich durch die Kleidung in die Lende von Gani gebohrt. So fanden wir den Patienten schwer krank mit starken Schmerzen, ohne jeglichen Schlaf und irgendwie auch verzweifelt auf seinem Sofa liegend. Die Familie war hilflos. Bereits nach der ersten Versorgung ging es ihm besser. Gani konnte nicht glauben, dass er ernst genommen wird, dass er sagen darf, wie sehr es weh tut usw. Als wir gestern bei ihm waren, da begrüsste er uns an der Haustür und strahlte uns an. Es ist ihm nicht mehr schwindelig, er hat sein Gleichgewicht wieder gefunden. Und er kann sich an seinen vier jungen Lämmern freuen, die auf seiner Weide neben dem Haus rumhüpfen und auch für Gani den Frühling bringen. Wenn er uns dann immer mit Tränen in den Augen die Hände küsst, dann denke ich daran, wie dieser Mann erniedrigt wurde und wie er sein Trauma langsam überwinden wird. Und er wird wieder seine Lämmer und Schafe versorgen können.